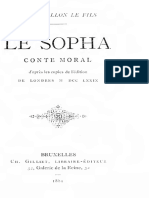Professional Documents
Culture Documents
Köppe, T. Kindt, T. Erzähltheorie 2014 (Fiktive Erzählwelten)
Köppe, T. Kindt, T. Erzähltheorie 2014 (Fiktive Erzählwelten)
Uploaded by
Tom Gründorf0 ratings0% found this document useful (0 votes)
57 views27 pagesOriginal Title
Köppe, T.; Kindt, T. Erzähltheorie 2014 (Fiktive Erzählwelten)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
57 views27 pagesKöppe, T. Kindt, T. Erzähltheorie 2014 (Fiktive Erzählwelten)
Köppe, T. Kindt, T. Erzähltheorie 2014 (Fiktive Erzählwelten)
Uploaded by
Tom GründorfCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 27
Reclam Sachbuch | Tilmann Képpe- Tom Kindt
Erzahltheorie
Eine Einfahrung
Reclam
[RECLAMS UNIVERSAL-BIRLIOTHER Nr. 17683
‘AlleRechte vorbehalten
(© 2014 Philipp Reclam jun, GmbH & Co. KG, Stutegart
Gestaltung: ComeliaFeyl, Friedrich Forseman
GGesamtherstellang: Reclam, Ditzingen. Printed in Germany 2014. *
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co.KG, Seatgart
SBN 978-5.15-017685-2
‘Auch als E-Book exhillich
‘wwwredam de
Inhalt
Gebrauchshinweise 9
1 Erzthltheorie 13
11 ZurBedeutung des Erzihlens
1.2 ZurErforschung des Erzihlens 15
13 Wasist Erzihltheorie? 23
1.31 Aufbau und Aufgaben derErzihitheorie 25
1.32 Beziehungen zwanderen Theorien” 3
3 Begriffe und Begrifsbestimmungen 37
2 DieEraahling 41
2.1 Mehrdeutigkeit von Erzihlung: 41
22 Das Problemeiner Definition von Erzihlung: 43
2.2.1 Eine minimalistische Definition von
vBraahlung 43
2.2.2 Eine gehalevollere Definition von
vBraihlung: 65
23 Fiktionale Erzahlungen 73
2.3.1 Fiktionale Augerungen und fiktive
Erzihlwelten 8
2.5.2. Die Rolle des fiktiven Erzahlers in fiktionalen
Eraahlungen 84
2.4, Literarische Erzihlungen als komplexe
Erzihlwerke 97
3 Aspekte des Erzihlten 103
3.1 Die Handlung von Erzihlwerken 103
3aa Handlung 103
312 Handlungsstringe 108
343 Handlungsmuster nz
Inhale
5
3.2 Fiktive Erzihlwelten undihre Bewohner 5 Anhang
3.21 Internerundexterner Standpunkt 16
3.22 FigurenalsPersonen 120 | Wegbereiterinnen und Wegbereiter der Erzihitheorie 259
3.23 Figurenals Artefakte 18 . Literaturhinweise 263
3.2.4 Figurenals Bedeutungstriger 146 Primisliteratur 263
3.2.5 Funktionen der Figurengestaltung 149 Filme 266
3.2.6 Mentale Figurenmodelle 153 | Sekundatliveratur 267
3.2.7 Typen von Berichungen zwischen Figuren und |
der Witklichkeit 154 | Namenregister 288
3.28 Identitit und Ontologie von Figuren 158 | Sachregister 291
33 Ebenendes Erzihlens 161 Dank 254
3.3.1 Rahmen-undBinnenerzihlung 162 |
43.3.2. Verhiltnisse zwischen den Erzihlebenen 174 |
4 Die Darstellung von Erzihlwelten 180 |
4.1 Wielisstsich die Zeitstruktur von Eraahlungen |
gestalten? 80 |
41.1 Tempo 80 |
412 Ordnung 184
4:13 Frequenz 389
42 Wie mittelbarist die Darstellung des Erzihlten? 192 |
43 Aus welcher Perspektive wird erzihlt? 208 |
43.1 Interne Fokalisierung 208 |
4.32 Externe Fokalisierung 226
433 Nullfokalisierung 230
434 Weitere Konzeptionen der Perspektivierung:
‘Autor, impliziter Autor und Leser 233
44 Wie (un)zuverlissig wird erzihlt? 236
44:1 Das tuschende unzuverlissige Erzihlen 237
442 Das offen unzuvedissige Ereshlen 245
443 Dasaxiologisch unzuverlissige Erzihlen 250
6 Inhale Inhale 7
Die Analyse von Handlungen und die Theorie
miéglicher Welten
In den vergangenen Jahren sind verschiedene Versuche
‘unternommen worden, das aus der philosophischen Mo-
dallogik stammende Konzept sméglicher Welten« fir die
Literaturtheorie und hier vor allem fir die Narratologie
fruchtbarzu machen. Grofes Interesse hat im Rahmen
entsprechend orientierter Ansitze nicht auletzt die Ana-
lyse der Handlungen fiktionaler Erzahlungen gefunden.
Die in diesem Kontext entstandenen Ansitze laufen, so
unterschiedlich sie im Detail sein mégen, einhellig auf
die Forderung hinaus, bei der Plotrekonstruktion nicht
allein die iatsichliche Welt (actual world) einer Erzih-
Tung, sondern auch die in ihr gestalteten »méglichen
‘Welten« (possible worlds) in den Blick 2u nehmen, also
beispielsweise auch vom Erzahler nahegelegte, aber aus-
bleibende und von einzelnen Figuren gewiinschte oder
befiirchtete, aber nicht eintretende Entwicklungen in der
Handlungswelt**
Es muss hier auf eine eingehende Prisentation und
Diskussion entsprechender Vorschliige verzichtet wer-
den, es soll aber zumindest kurz angedeutet werden,
‘weshal sie in den Uberlegungen des vorliegenden Kapi-
tels keine Rolle gespielt haben: Hierfar gibt es zunichst
den pragmatischen Grund, dass die Possible-worlds-An-
sitze der Handlungsanalyse von einem Plothegriff ausge-
hhen, der dem von uns vorgeschlagenen nicht entspricht.
Entscheidend fiir die Vernachlissigung der »Mégliche-
Weltens-Modelle ist aber der systematische Einwand,
166 Vgl.Ryan 1991; Ronen 1994; Surkamp 2002.
167 Vgl. Dannenbergi995; Gutenberg 2000.
ig. 3 Aspekte des rahlten
Benennung einzelner Aspekte erzahlter Welten handelt,
zu deren Beschreibung die herkimmliche Narratologie |
bereits hinreichend ausgefeilte begrifflche Ressourcen |
zur Verfigung stellt. Problematisch erscheinen die be-
treffenden Terminologien dabei nicht zuletzt, weil sie |
durch die Ubernahme von Begriffen aus der Modallogik |
den irrefihrenden Eindruck nahelegen, sie seien mehr |
als bloSe Terminologien, nirlich Theorien mit explan:
tiver Kraft**
In diesem Teilkapitel, so kinnen wir zusammenfassen, haben,
‘wirbestimmte Ausgestaltungsmdglichkeiten des Gehaltskom-
plexer literarischer Erzihlungen (Erzihiwerke) niher charak-
terisiert, Literarische Erzahlwerke konnen von musterhaften,
Erzihlungen, wie wirsie in Kapitel 2.2 eingefiihrt haben, unter
anderem darin abweichen, dass wir in ihnen mehrere, chrono-
logisch geordnete und sinnhaft verknipfte Freignisfolgen,
4h, Handlungsstringet oder sPlotsi, unterscheiden kénnen.
Solche Handlungsstringe knnen auf unterschiedliche Weise
miteinander verbunden ~ oder nicht verbunden ~ sein, und sie
kénnen auf zahlreiche Weisen (z.B. anhand inheltlicher Ge-
sichtspunkte) typisiert werden.
dass es sich bef shnen letatlich nur um Terminologien zur |
‘32 Fiktive Eraihlwelten und ihre Bewohner
In diesem Abschnitt widmen wir uns einem besonders wichti-
igen Aspekt des Erzihlten bw. der von der Eraahhing darge-
stellten (Gktiven) Welt: den Figuren. Kaum eine Erzshlung
168 Vgl. Heytich 2000, $. 90-94; Klauk/K8ppe 2000.
442 Fiktive Erzahlwelten undihre Bewohner 15
Jhandelt nicht in der einen oder anderen Weise von Menschen
‘oder zumindest menschlich wirkenden Dingen oder Lebewe-
sen; das gilt zumindest fiir Erzahltexte, die unter den rgchalt-
vollen« Begriff der Erzahlung fallen (s, Kap. 22.2) und die den
Groffteil der (fktionalen) literarischen Erzihlliteratur aus-
‘machen (s. Kap. 2 und 2.4). Wir beginnen (3:24) mit einer
fandamentalen Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen
Standpunkten Figuren gegentiber und der Annaherungan eine
Definition des Figurenbegriffs. Darauf aufbauend erléutern
wir (2.2) Figuren als Bestandteile ktiver Welten; (3.2.2) Figu-
ren als Arcefakte; (3.2.4) Figuren als Bedeutungstriger; (32.5)
Funktionen von Figuren und Figuenkonzeptionen; (3.2.6)
‘mentale Figurenmodelle; (3.2.7) Typen von Bezichungen zwi-
schen Figuren und der Wirklichkeit; und schlieSlich (328) die
dentitt und Ontologie von Figuren.
Vieles von dem in diesen Abschnitten Gesagten gilt in hn-
licher Weise auch firandere Elemente der Erzahlwelt, twa fir
dargestete Gegenstinde, Orte, Situationen oder Ereignisse;
auch diese kénnen als Bestandteile fktiver Welten und als
textbasiert angesehen werden, aber Bedeutungen verfiigen,
fanktional bestimmt sein usw. Wir konzentrieren uns in un-
serer Darstellung aber auf Figuren nicht zulett deshalb, weil
sie neben ihrer Wichtigkeit auch besonders anschauliche De-
‘monstrationsobjekte sind.
324 Interner und externer Standpunkt
In Kapitel 241 haben wir bereits auf die Unterscheidung
zwischen fiktionalen Erzahltexten einerseits und fiktiven
Erethlwelten andererseits aufmerksam gemacht (s. S. 81f),
Die Rede von einer fiktiven Erzihlwelt ist eine sprachliche
Ablirztng dafir, dass man im Umgang mit fiktionaler Li-
teratur dazu aufgefordert wird, sich eine Reihe von Gegen-
6 3 Aspekre des Erzihleen
stinden und Sachverhalten vorzustellen. Eine fiktive Erzahl-
welt ist nichts anderes als die Summe dessen, von dem die-
se Vorstellungen handeln, An dieser Stelle muss das Gesagte
in einer wichtigen Hinsiche erginzt werden. Aus dem Ge-
sagten ergibt sich nimlich, dass man fiktionalen Erzahltex-
ten gegentiber zwei grundsitzlich voneinander verschiedene
Standpunkte einnehmen kann: Man kann sie einerseits als
Texte betrachten, die es in unserer Welt gibt, die tiber be-
stimmte sprachliche (syntaktische, stilistische, semantische,
intertextuelle u.a.) Bigenschaften verfiigen und die uns 2u
ciner regelgeleiteten Vorstellungsaktivitit einladen. Ande-
rersets sind die Dinge, von denen fiktionale Texte handeln,
in unserer Vorstellung real. Wir kénnen uns in unserer Vor-
stellung den von diesen Texten behandelten fiktiven Sach-
vethalten in vielerlei Hinsicht genauso widmen, als handele
es sich um reale Sachverhalte. Im angelsichsischen Sprach-
raum ist es dblich, diese zwei Weisen, einen fiktionalen Er-
zahltext zu betrachten, einem internen bew. externen Stand-
punkt (point of view) zuzuordnen.* Ein Beispiel kann das
veranschaulichen. Das 1910 veroffentlichte Buch Die Aufzeich-
rungen des Malte Laurids Brigge von Rainer Maria Rilke be-
sginnt folgendermafen:
1, September, rue Toultier.
So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich wairde
cher meinen, es stirbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich ha-
bbe gesehen: Hospitiler. Ich habe einen Menschen geschen,
wwelcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten
sich um ihn, das ersparte mir den Rest
169 Vel Lamarque 1996,$.2
70 Rilkexs10,8.7,
32 Fitive Erzthlweltenundihre Bewohner 17
‘Wenden wir uns Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge vom internen Standpunkt aus zu, so kénnen wir bei-
spielsweise fragen, welche Erfahrungen Malte in der Gro8-
stadt macht oder in welcher Weise sich in den fragmentari-
schen Aufzeichnungen die Persénlichkeit Maltes ausdriicke,
Wir behandeln den Protagonisten aus dieser Perspektive also
als eine Person, die in unserer Vorstelhung real ist und tiber
personentypische Eigenschaften verfiigt. Nehmen wir gegen-
fiber Rilkes Text dagegen einen extemen Standpunkt ein, so
Ikénnen wir beispielsweise fragen, welche eigenen Erfahrun-
gen Rilkesin Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge ver-
arbeitet wurden, wie der Text komponiert ist, ber welche
sprachlichen Besondetheiten er verfigt, welche literaturge-
schichtlche Bedeutunger hat und dergleichen mehr. Insbeson-
dere kénnen wir von diesem Standpunkt aus auch fragen, wie
die Figur des Protagonisten konstruiert ist, d.h.beispielsweise,
mit welchen Ausdriicken sie eingefihhre oder wie vollstindig
sie beschrieben wird*
Die verschiedenen Aspekre der Figurenanalyse, die wir wei-
ter unten vorstellen, beruhen auf der Unterscheidung von in-
1371 Da die Auftcichmogen des Malte Laurids Brigge (eurindest
anfangs) die Form eines fkriven Tagebuchs haben, kinnen wit
stilissche Uberlegungen tbrigens zuch vom internen Stand-
punktausanstellen: Wir linnen unsnimlich ragen, ber welche
(Gkuiven sulistischen Bigenschaften der (Sikive) Tagebuchboeriche
des (Giktiven) Malte vefigt. Oder anders gesage: In der fikiven
‘Weltschretbt Malte ein reales Tagebuch, das wie jedes Tagebuch
‘ther bestimmeestilitsche Eigenschaften verfig. Tagebuch-
fiktionen zeichnen sch llgemein dadurch sus, dass wir die Sitze
des fitionalen Erzahltextes nicht nur 2um Anlassnehmen, uns
bestimmte Dinge vorzustelen, sondern dass wir uns auch vor
den Sitzen des Textes vorstellen, es handele sich um die Aufeelch-
sungen des Tagebuchschreibers,s.Kap.3.23.
18 3 Aspelae des Er2ahlten
‘temem und externem Standpunkt. Wie berets erwint, be-
tri die Unterscheidung jedoch grundsitzich alle beschrie~
enen Gegenstinde fiktionaler Erzahltexte, nicht nur die
Figuren: Alles, von dem in einem fiktionalen Erzihltext die
Rede ist, kinnen wir aufbeide Weisen betrachten.
Vor dem Hintergrund der Unterscheidung von internem
und externem Standpunke stelle sich die Frage, welchem der
beiden Standpunkte sich die Rede von »Figuren verdankt. Es
liegt nahe, den Term Figur’ dem extemnen Standpunkt 2uz
cordnen: Malteaus Die Aufzcichnungen des Malte Laurids Brigge
iscnur vom externen Standpunkt aus gesehen eine literarische
Figur; vom internen Standpunkt aus gesehen handele es sich
meinen Menschen aus Fleisch und Blut. Nichtsdestotrorz soll,
dor Begriff der Figur genau diesen Doppelaspekt einfangen: Er
bbehandelt ene Personen/Menschen (oder quasi-menschlichen
Gegenstinde), die Gegenstand eines fiktionalen Mediums
sind. Die folgende Definition versucht, dies 2u berticksichti-
gen: Bin fktionales Medium beschreibt genau dann cine Figur,
‘wenn es zu der Vorstellung einladt, dass das Beschriebene ein
“Mensch / eine Person (oder ein quasi-menschlicher Gegenstand)
ist. Diese Definition lisst eine Reihe von Dingen offen: So
‘kénnen Figuren Bestandteile unterschiedlicher fiktionaler Me
dion sein (u.a, literarischer Texte, Filme, Horspiele), und die
Formulieruing sbeschreibts list unbestimmt, auf genau wel-
che Weise das Medium die Figur charakterisier.”™ Ferner
bleibt offen, genau welche Attribute Menschen oder Personen
auszeichnen (baw. genau welche Attribute eine Beschreibung
zu einer Menschen- oder Personen-Beschreibung machen)
Den Verweis auf quasi-menschliche Gegenstinde haben wir
aufgenommen, weil in literarischen Texten natirich nicht nur
Menschen auftreten kénnen, sondern auch sprechende und
172 Vgl-Eder u.a] 2010, $.30-38.
42 Filsive Ereahlwelten und ihre Bewohner 19
handelnde Tiere, Pflanzen, Roboter, Damonen oder ahnliches,
Ist dies der Fall, so verfiigen diese Wesen aber tiber Attribute
(wie etwa das Sprechen oder Handeln), die sie als quasi-
‘menschlich auszeichnen.*
3.2.2 Figurenals Personen
Vom internen Standpunkt aus gesehen sind Figuren Lebe-
wesen, Meist handelt es sich um Menschen, hiiufig - wenn
der Erzihltext realistischen Darstellungskonventionen folgt
(6. 8.140-142) —handelt es sich um Personen, denen im gro-
Sen und ganzen Bigenschaften zugesprochen werden kénnen,
wwie wir sie auch uns selbst und unseren Mitmenschen zter™
Kennen, Dazu gehoren insbesondere ein breites Spektrum in-
nerer(geistiger) und suSerlicher Charakteristika, wie etwa die
Fahigkeiten zu denken und zu empfinden, bestimmte Bedirf-
nisse und Absichten, intentionales Handel, soziale Beziehun-
gen usw, (eine offene Liste solcher Charakteristika wird im
folgenden entwickelt) Fiktive Personen beschreiben tind ana-
lysieren wir dementsprechend auch, aber nicht aur oder aus-
schlieGlich mit denselben Begriffen und Verfahren, die wir
heranziehen, wenn wir Personen in der Wirklichkeit verste-
hen wollen."
Da fiktive Figuren vom internen Standpunkt aus gesehen
Bewohine nr Sven Wels nee such te Bigs
bezeichnet wird (s. Kap. 234, S. 82, und 32, , 104), kann man
173 Vel. auch Margolin 1995; Eder 2008, 8. 62-69; Eder (u.2] 2010,
5.610,
174 Dabetistallerdings2u beachten, dass nicht-iktionale Aussagen
Aber Figuren, wie sie beispielsweise Leser tigen eine andere
logische und pragmatische Seruktur haben als die Aussagen dber
Figuren, de sich in fktionalen Texten finden; vel. zu dieser
‘Unterscheidung einfthrend Lamarque 996,$.29-31.
203 Aspekte des Erzahlten
die Untersuchung von Figuren als Personen auch als diegetische
Figurenanalyse bezeichnen.”* Mégliche Aspekte der diegeti-
schen Figurenanalyse (unter den Bedingungen einer realisti-
schen Darstellungskonvention) sind:
~ Psychische Konstitution, Charakter: Uber welche Persénlich-
kkeitsstrukcur verfige die Person? Was sind ihre Bedirfnis-
se, Prinzipien, Verhaltensdispositionen? Ist ihr Charakter
cher statisch oder entwickelter sich? usw.
— Auferes, Verhalten: Wie sieht die Person aus? Uber welche
physischen Merkmale, welche Kleidung usw. verfigt sie?
‘Wie agiere sie habituell und situativ? usw.
~ Mentales: Was glaubt, denkct,fihlt, wiinscht, plant, fircheet
‘usw. die Person in Bezug auf sich selbst und die Welt?
‘Warum verfigt sie tiber diese Einstellungen? Was hile sie
fir wichtig, richtig, normal, geboten usw.? Wie ist das Ver-
haltnis von bewussten und unbewussten Anteilen im Men-
talen der Person? usw.
~ Soziale Beziehungen: In welchen sozialen Bezichungen steht
die Person? Wie verhiltsie sich zu anderen? usw.
= Sozialer Status, Habitus, Rollenproblematiken: In welchen
Unifeldern bewegt sich die Person? Welchen sozialen Status
hat sie innerhalb eines Umfelds? Welche Rollen fille sie aus,
und wie verhilt sie sich zu Rollenangeboten oder Rollen-
szwvingen? usw.
= Kulturelier, gesellschaftlcher, historischer Hintergrund: In
welchen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen
Umfeldern bewegt sich die Person? in welcher Weise pri-
gen oder beeinflussen diese Umfelderihr Leben?
= Lebensgeschichtlicher Hintergrund: Welche Selbst- und
Fremdzuschreibungen gibt es in Bezug auf die Vergangen-
175 Vgl-2um Folgenden Eder2008, 5.144 0.6.; Kunda 1999,
32 Fiktive Erathlwelten und re Bewohner 121
hit, Gegenwart und Zukunfe der Person? Gibtes Entwick- gen, die das soziale Geschlecht von Figuren oder ethische
lungen? Gesichtspunkte charakterisieren.°
Zweitens kann man sich durch die Wahl einer Bezugs-
theorie mehr oder weniger weit von der im historischen
Entstehungskontext des Textes angelegten Beschreibung.
der Figur entfernen. Ein plakatives Beispel ist die An-
‘wendung psychoanalytischer Kategorien auf Texte aus
der Zeit vor der Entwicklung der Psychoanalyse. Solchen
Interpretationen wird manchmal der Vorwurf gemacht,
sie seien anachronistisch,”” Problematisch ist dieser Vor-
‘wart schon deshalb, weil die Pychoanalyse oderin neue-
rerZeitz.B. Kognitionspsychologie oder Traumatherapie
anthropologische Konstanten 2u beschreiben versuchen,
die nicht erst ab einem bestimmten Datum gelten. Au-
Serdem ist zu beachten, dass mit der diegetischen Figu-
Diese Liste von Aspekten und Fragen der diegetischen Figu-
renanalyse ist offen. Allgemein gil, dass vom jewels in Rede
stehenden Einzeltext abhingig ist, wie prominent Eigenschaf-
ten des jeweiligen Typs sind und ob sie diberhaupt eine Rolle
spielen. Auch Gattungs- und Genre-Konventionen sind wich-
tig, So wird beispielsweise im Bildungsroman die lebensge-
schichtliche Entwicklung eines Individuums betont, im histo-
rischen Roman geht es um den Wandel geschichtlicher und
gesellschafticher Zusammenbinge, bei denen Figurenkon-
stellatonen oft nur einen exemplarischen Wert haben, und im.
Detektivroman stehen die psychische Konstitution eines Ti-
ters (seine Motive, Pline, Absichten) sowie die psychologische
und kriminologische Kompetenz des Ermittlers (seine Kombi- renanalyse unterschiedliche Absichten verfolgt werden |
nationsfahigkeit und sein Einfuhlungsvermégen) im Vorder- konnen: Wenn man rekonstruieren méchte, wie Figuren
grond, zu ihrer Entstehungszeit wahrgenommen wurden oder
wahrgenommen werden sollten, verfolgt man andere
Ziele als mit einer Beschreibung von Figuren, die diese
beispielsweise als besonders interessant oder lehrreich
Bezugstheorien der diegetischen Figurenanalyse
Oben wurde gesagt, dass man sich bei der diegetischen
‘Analyse von Figuren (unter den Bedingungen realis-
| tischer Darstellungskonventionen, s. 8. 140-142) jener
Theorien bedienen kann, die man auch im Alltag ver-
wendet. Diese Annahme sollte in zweierlei Hinsicht
qualifiziert werden:
Erstens haben sich verschiedene literaturtheoretische
Seeimungen etabliert, die bestimmte Aspekte der darge-
stellten Personen in den Vordergrund riicken und dabei
auf spezialiserte Theorien und deren Vokabular 2urtick-
| rel, Prominent sind etwa bestimmte Sielarten der
psychoanalytischen Figurenanalyse oder Untersuchun-
22 3 Aspektedes Erzshiten
erscheinen lassen.’* Die Wahl von Bezugstheorie und
Beschreibungssprache hingt damit in erster Linie von
den Interessen des Interpreten ab, und der Vorwurf des
‘Anachronismus ist erst dann gerechtfetigt, wenn man
sich zum Ziel gesetzt hat, das historisch intendierte Ver-
stindnis einer Figur 2u rekonstruieren, und ihr dennoch
igenschaften uschreibt, die nicht historisch verbingt
sind,
176 Vel. tke /Buter 2010; Lanser 986; Phelan 2005,
197 Vel Beardsley 1981, 5.246,
198 Val. der2008, 5.2976 0.6.
4.2 Filive Erzshlwelten und thre Bewohner
Es ist plausibel anzunchmen, dass sich unser Interesse an
fiktionalen Erzihlwerken nicht zuletat dem internen Stand-
punkt verdankt und, genauer, auf einem Interesse an den
Schicksalen der in ihnen dargestellten fiktiven Personen be-
rruht, Leser haben zu allen Zeiten in den Anliegen und Pro-
‘blemen von Figuren ihre eigenen Probleme wiedererkannt. Li
terarische Figurendarstellungen werden in diesem Sinne bis-
wweilen als ein Simulations- oder Experimentierfeld angesehen,
in dem allgemeinmenschliche Moglichkeiten dargestellt oder
ausprobiert werden:
Fiktive Personen sind nicht nur Gegenstand unseres Nach-
denkens und unserer Beurteikungen, sie sind auch die Haupt-
gegenstinde affektiver Anteilnahme sowie komplexer kogniti-
ver, affektiver und volitiver Einstellungen. Schon wahrend des
Lesens/Hrens einer Erzihlung bilden Rezipienten typischer-
weise ein reiches Spektrum affektiver Einstellungen gegen-
ber fiktiven Personen aus, zu denen beispielsweise Bewunde-
rung, Mitleid, Furcht oder Abscheu gehéren mégen. Dabei
kkann man die Gefithle der Rezipienten mit denen der Figuren,
vergleichen." Mogliche Relationen sind etwa Projektion (Leser
‘ibertragen ihre Gefiihle auf Figuren), Empathie/Simulation
(Leser dbernehmen die Gefithle von Figuren) oder auch Diver-
genazen (Leser haben andere Gefiihle als Figuren und reagieren
2.B. mit Arger auf deren Freude). Zugleich entwickeln Leser
normalerweise eine Reihe von Wiinschen in Bezug auf das
179 Vgl. Lamarque/Olsen 1994, 8. 265; Klauk/Képpe 2010;
Klsukzon,
180 Vgl. Eder 2008, Kap. 13; Fler 2007, Inder Kunstphilosophie ist
ie Frage intensiv diskutiere worden, wie genas zu veretehen ist,
ass Personen affetive Einstellungen gegentber fltiven Gégen-
stinden ausbilden, vn denen sie glechzeitigannehmen, das ie
‘nicht existeren; fr eine Ubersche und Diskussion vel. Levinson.
19973 Képpeaoos,
124 3 Aspeite des Erzahlten
Schicksal der Figuren - etwa, dass es ihnen gut oder aber
schlecht ergehen mége.
‘Zwei Punkte missen abschlie@end hervorgehoben werden:
-Erstens gibt es natirlich wichtige Unterschiede zwischen fk
‘ven tnd realen Personen; in unserem Zusammenhang interes-
siert insbesondere, in welcher Weise die Medialiit fiktiver Fi-
guren (d.h, die Tatsache, dass sie durch Erzahltexte revozierti
‘werden) beeinflusst, ob und wie wir sie (in unserer Vorstel-
Jung) als Lebewesen oder Personen wahrnehmen. Zweitens
riissen wir abschlie@end noch einmal die Frage stellen, ob alle
Figuren in gleichem Ausma als diegetische Figuren (bzw.
filaive Lebewesen) wahrgenommen und untersucht werden
nen.
(@) Jens Eder zahle verschiedene Aspekte auf in denen die Fi-
gurenrezeption von der Wahrnehmung von und Auseinander-
setzung mit realen Personen abweicht Wir geben hier eine
gerafite Darstellung einer Auswahl, angepasstauf den Fall lite-
rarischer Erzahltexte:
~ Kommunikations- und Fiktionsbewusstsein: Kompetente Le~
ser fiktionaler Erzihltexte wissen, dass sie es mit einem fik-
tionalen Medium zu tun haben, und sie kénnen sich diese
Tatsache jederzeit bewusst machen. Dazu gehért unter
anderem, dass wir uns den Artefakt-Charakter sowie die
symbolischen und funktionalen Aspekte von Figuren vor
‘Augen fidhren kénnen (darauf wird in Abschn. 323-325
zuriickzukommen sein).
— Wahrnehmungssituation: Es macht einen wichtigen Unter-
schied, ob wir uns auf der Basis einer Erzhlung ein (imagi-
natives) Bild einer Person machen, oder ob wir eine Person
181 Eder2008,. 20-228; vglauch ebd., S.239-242; Lamarque 2007
182 Siehe Kap.23,$.77£.; pl Carroll1990, 8. 63-68.
432 Fktive Erethlweleen undihre Bewohner 125
in der Wirklichkeit sehen, horen oder anderweitig tinmittel-
bar wahmehmen. Die Vermitteltheit der nur vorgestellten
‘Wahmehmung bringt eine Reihe von Faktoren mit sich, zu
denen der Grad der Konzentration auf die Person und die
‘Ausschaltung von Stérfaktoren, die Entlastung vor Hand
lungsdruck und die Detailliertheit der mentalen Reprisen-
tation gehdren kénnen.*
~ Abweichungen fltiver Welten und Wesen von der Realitt:
Biktive Welten knnen von der Wirklichkeit in verschie-
denster Weise abweichen (s. Abschn.32.),undentsprechend
kkénnen auch die in dhnen lebenden Wesen von den in unse~
rer Weltlebenden oderauch nurméglichen verschieden sein,
Bestimmte Erzahlgentes wie Science Fiction oder Horror
snutzen dies systematisch aus, aberauch in ansonsten realisti-
schen ErzihlungenweichenbeispiclsweisedieKompetenzen
fiktiver Personen von denen wirklicher Personen manchmal
ab; soverfiigen beispielsweise itive ch-Erzihlertypischer-
weise Uber ein Erinnerungsvermogen, das dem wirklicher
Personen weit iberlegen ist. Unser Zugang zum Mentalen
fileiver Personen kann nahezu unbeschrinkt sein."
~ Pragmatische Regeln der Kommunikation: Bereits in Kapitel
222, .536, haben wir darauf hingewiesen, dass die narrative
Kommunikation bestimmten pragmatischen Regeln unter-
liegt, deren Befolgung wir zunichst einmal annehmen; so
‘gehen wir beispielsweise davon aus, dass die Beschreibun-
gen eines Erzahltextes wahr (bw. fiktional wahr, s. Kap. 23
‘und 4.4),vollstindig und relevant sind, Eine solche koopera-
tive Verlisslichkeit und (rationale) Serukeurfehlt der oftmals
durch Zufalle bestimmten Wahrehmung von Personen in
der Wirklichket.
183 Vgl.Képpe 2008, 5187-18.
184 Vgl.Cohni978,
126 3 Aspekte des Erzthlten
= Suche nach Sinn und Zielen der Kommunikation: Weiterhin
‘gehen wir davon aus, dass Personen mit kommunikativen
“Akten bestimmte Ziele verfolgen: das gilt sowohl fir den
‘Akt als ganzen (s. Kap. 2.22, S. 70f) als auch fiir einzelne
“Aspekte. So ist beispielsweise der Name einer fiktiven Per-
son oftmals ein sprechendes Detail der Figurenbeschrei-
bung.**
~ Perspektivierung und Vermitteltheit durch Erzdhlinstanzen:
Devon eincm Erle Dares ann of vschide-
ne Weisen perspekiviert und vermittet sein, etwa durch
TTechnikeen der Fokalisierung (s. Kap. 4.3).
~ Narrations- oder medienspecifische Wissensbestinde: Sclie8-
lich greifen wir bei der Figurenrezeption auf eine Vielzahl
‘medienspezifischer Wissensbestinde zuriic, etwa auf Wis-
sen zum Text, zu Gattungen oder allgemeinen Darstellungs-
‘mdglichkeiten und -konventionen, zum Autor, zur Entste-
hhungszeit, zur Epoche usw."
(2) Werden alle Figuren in gleichem Mae vom internen
Sndpunie aus gesehen und als fiktive Lebewesen wahrge-
rnommen? Diese Frage miissen wir verneinen.® Figuren kin-
nen im Erzihltext nur skizziet sein, so dass unsere Vorstellun-
gen von der Person stark unterdeterminiert sind ~das giltetwa
fir die Figuren, die im Film blofe Statisten sind oder diein
nem Erzihltext die anonymen Mitglieder einer Menschen-
‘menge ausmachen (vel. die Rede von »Leutene im oben, S.117,
zitierten Abschnitt aus Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge). Bei manchen Figuren aberwiegen symboli-
sche Qualititen, etwa dann, wenn in einer Erzihlung die per
185 Vel. Pfister 2001, 5. 2216; Bder2008, 5.336.
186 gl. Titzmanm 1977, Kap. 32: der 2008, 8. 224-228.
187 Val. Eder 2008, 8.143-145,
42 Fiktive Eeethlwelten und ihre Bewohner 127
sonifizierte Gerechtigheit auftritt oder wenn Figuren stark ka-
rikiert sind. Manchmal hindere uns auch der Artefakt-Charak-
ter einer Figur, dem Erzahltext gegeniber einen internen
Standpunkt einzunehmen. In Kapitel 4.4, S. 2546, wird auf
Daniil Charms’ experimentellen Text »Blaues Notizheft Num-
‘mer io¥ eingegangen werden, in dem von einem »Rotschopf
die Rede ist, den man sich beim besten Willen niche als fiktive
Person vorstellen kann (wobeiallerdings fraglich ist, ob dieser
‘Text dberhaupt noch als Erzahlung einzuseufen ist).
3.23 Figurenals Artofakte
Vom extemnen Standpunkt aus geschen sind Figuren Artefak
te, d.h., von Autoren geschaffene Aspekte von Erziltexten.
Die auf den Artefakt-Charakter abziclende tbergreifende Frage
der Figurenanalyse lautet »Wie ist die Figur gemacht baw. ge-
staltet?s. Sowohl diese Gestaltung selbst als auch ihre Rekon-
struktion bezeichnet man auch als )Charakterisierung.
Grundsitzlich kann wohl so gut wie jedes sprachliche Detail
des Ercdhltextes einen Beitrag zur Gestaltung einer Figur leis-
ten, und die Systematisierang der Gestaltungsmittel und
-strategien ist schwierig. Mit Eder unterscheiden wir ~ ange-
passt an das literarische Erzahlen ~im folgenden 2wischen ele-
‘mentaren (sprachlichen) Mitteln der Figurendarstellung, iber-
sgxeifenden Strukturen der Figurendarstellung und komplexen
Figurenmodellen.
Elementare (sprachlche) Mitel der Figurendarstellung
Die allgemeine Stilistik und Rhetorik z3hlen zahlreiche Mittel
auf, die beeinflussen, wie wir einen sprachlich dargestellten
Gegenstand auffassen: Neben mikrostilistischen Miteln (ie
188 Bd, 5. 32x37,
128 3 Aspeite des Brhlten
exwa Wortwahl, Wortart, Tropen, Satzart, Satzlinge, Lautqua-
lititen usw.) kommen auch makrostilistische Einheiten in Fra-
ge (wie etwa Gruppen- oder Individualstile, Stilfarbungen
‘usw. Grundsitzlich steht Autoren bei der Figurendarstel-
Jung natirlich das gesamte Repertoire unserer sprachlichen,
‘Ausdrucksméglichkeiten zur Verftigung ~ das hier selbste-
ddend nicht exschépfend aufgelistet werden kann. Auch im Fall
der literarischen Erzihlung werden tnsere Vorstellungen von,
filtiven Personen unter Umstinden neben dem Text noch
aus weiteren Quellen gespeist: Texte und Paratexte konnen
Illustrationen enthalten, die Figuren knnen, wie evwa in der
“Autofiktion oder im Schliisselroman, realen Vorbildern nach-
empfunden sein (s. S. 154~158); auferdem gehen, wie wir be-
reits unter 3.2: angemerkt haben, in unsere Vorstellungen im~
mer auch diverse weitere anthropologische, medienspevifische
u.a, Wissensbestinde ein. Noch komplexer sind die elementa-
ren Mittel der Figurendarstelhung in nicht (cein) sprachlichen
Medien, erwaim Spielfilm.»°
Ubergreifende Strukturen der Figurendarstellung
Die elementaren Mittel der Figurendarstellung weisen weiter-
hin tibergreifende Strukeuren auf, die sich nach verschiedenen
Kriterien sortieren und voneinander unterscheiden lassen:"*
= Grade der Direktheit: Figuren kénnen im Erzihltext direkt
Deschrieben werden (»Peter war ein grofer Mann von 3s Jah-
ren, der regelmaig zum Angeln zu gehen pflegte.«). Gegen-
stinde dieser Beschreibungen kénnen alle Aspekte der fikti-
ven Person sein, die wir in Abschnitt 3.22 aufgefiihrt haben
189 Vel. Sowinski 1991
190 Vel. dazu niher Eder 2008, 5. 325-358.
191 Vglebd., $.360-270; Jannidis2004,5. 2206.
‘32 Hiktve Erethlwelten undihre Bewohner 129
(also u.a. thr Aussehen, ihre AuSerungen und sonstigen
‘Handlungen, thre sozialen Beziehungen und sonstige Kon-
texte usw). Figuren konnen auch indirekt charakterisiert
‘werden, indem Dinge dargestellt werden, von denen sich
Schitisse auf die Eigenschaften der iktiven Person ziehenas-
sen. So kann etwa das Umfeld der fikeiven Person beschrie~
bben werden, etwa das, was andere fiktive Personen iiber sie
denken oder das, was die Figur besitzt oder nichtbesitzt. Da-
bei ist zu beachten, dass der Ausdruck ibeschreiben: hier in
«einem weiten Sinne zu verstehen ist. Der Vampir Dracula in
Bram Stokers gleichnamigem Roman wird etwa dann indi-
rektcharakterisiert, wenn eines seiner Opfer bei seinem An-
blick aufschreit (dieses Aufschreien ist dabei keine Beschrei-
‘bung im engeren Sinne). Die indirekte Charakterisierung,
das zeigt dieses Belspiel, erfordert einen mehr oder minder
naheliegenden oderauch komplizierten Schluss aufrelevante
Eigenschaften der fiktiven Person. Liegt eine Person bei-
spielsweise im Krankenhaus, so schlie@en wir schnell darauf,
dass sie gesundheitliche Probleme hat; trigtsie, wie einer der
Protagonisten aus Edgar Allen Foes Erzihlung Das Fa
Amontilado eine Maurercelle, so miissen wir ber bestimm-
te Wissensbestinde (in diesem Fall iber das Freimaurertum)
verfligen, um der fiktiven Figur bestimmte Eigenschaften
zuschreiben zu kénnen. Direkte und indirekte Charakteri-
sierung gehen oft Hand in Hand: Im Fall des Figurenrede bei
spielsweise erfshren wir einerseits direkt, was de fistive Per-
son sagt; andererseits lassen sich aus dem Gesagten oftindi-
rekte Schliisse etwa auf ihre Absichten oder Wiinsche oder
ihren Charakterziehen.*
192 Zueiner anders interpretierten Unterscheidung zwischen
‘direkuer' und indirekterCharakterisierung vel. Rimmon-Kenan.
1983, Kap.
10 3 Aspektedes Erzihlten
= Ausfiihrichkeit: Figuren kénnen mehr oder minder ausfihr-
lich charakterisiert werden, wobei sich yAusfubrlichkeit hier
lediglich auf die Menge der Beschreibungen bezieht. Rele~
vant ist dabei auch, ob sich Aussparungen (dh. bestimmte
Aspekte der fktiven Figur, die dezidiert nicht beschrieben
werden) oder Redundanzen (dh. Aspekte der fiktiven Per-
son, die mehrfach, gef. mit verschiedenen Beschreibungen,
charakcerisiert werden) finden. Aussparungen und Redun-
danzen sind wichtige Mittel der Charakterisierung, die un-
sere Aufmerksamkeit auf die fraglichen Aspekte der fiktiven
Person lenken,
~ Verteilung/Dichte/Reihenfolge: Elementare Erzahlungen
(6. Kap. 22:1) schildern eine Abfolge von Ereignissen, die auf
bestimmte Weise verkniipft sind. Far die Konstitution fikti-
ver Personen kann die Verteilung der Charakterisierungen
im Erzdhlverlauf von Bedeutung sein, also etwa, ob eine Fi
gur gleich zu Beginn der Erzahlung eingefilhre wird und
dann nicht mehr in Erscheinung trtt, oder ob sie bis zum
Schluss prisent bleibt. Die Dichte der Charakterisierung be-
twiffe die Frage, ob die fktive Person »geballty, dh. gleichsam
auf einmal, charakterisiert wird, oder ob wir uns aus vielen
Mosaiksteinchen ein Bild zusammensetzen miissen. Die
Reihenfolge bestimmt, wie die Beschreibungen der fiktiven
Person (nicht in Bezug auf den Erzahltext als ganzen, son-
dern lediglich relativ 2u anderen Beschreibungen der fkti-
vven Person) angeordnet sind; so kénnen wir beispielsweise
vom AuBeren der Figur 2u ihrem innenleben oder von einer
indirekten Charalterisierung zu einer direkten geftihrt wer-
den. Die Verteilung, Dichte und Reihenfolge der Charakte-
risierungen kann mehr oder minder markant oder eindeutig
angelegt sein, auBerdem sind die Charakterisierungsstrate-
sien frei kombinierbar.
~ Eraihlebenen/Mittelbarkeit: Komplexe Erzihlungen kénnen
32 Fiktiverzthlwelten undihre Bewobner
liber verschiedene Ebenen verfiigen (S. Kap. 33). Je nach-
dem, auf welcher Ebene etwas iiber eine fktive Person aus
gesagt wird, ander sich der Grad der Mittelbarkeit und ge-
gebenenfalls auch die Zuverlissigheit und Perspektivierung
des Mitgeteilten (s. Kap. 4.2 bis 4
~ Perspeltivierung: Die Charakterisierung einer Figur kann
sich einer mehr oder weniger Klar identifizierbaren Perspek-
tive verdanken, Dabet kann es sich wie im Fall der internen
Fokalisierung um eine identifizierbare Figur handeln (z.B.
uum den fiktiven Ereihler, aber auch um andere fiktive Perso-
nen, die der die 2u charakterisierende Person sprechen,
nachdenken 0.4). Die Charakterisierung kann dabei wie-
derum durch die charakterisierce Person selbst oder eine an-
dere Person ~und dies wiederum in An- oder Abwesenheit
der charakterisierten Person - vorgenommen werden. In
‘Thomas Manns Erzahlung Tristan beispielsweise werden die
Figuren durch den Erzahler ironisch dargestellt: Dr. Leander,
der Leiter des Sanatoriums Einfried, wird beispielsweise fol-
gendermafen eingefiht:
Mit seinem zweispitzigen schwarzen Bart, der hart und
Ieraus ist, wie das Rofthaar, mit dem man die Mabel stop,
seinen dicken, funkelnden Brillenglisern und diesem
Aspekt eines Mannes, den die Wissenschaft gekaltet, ge-
hrartet und mit stillem, nachsichtigem Pessimismus er-
fille hat, hile auf kurz angebundene und verschlossene
‘Art die Leidenden in seinem Bann [..]
Fr Ironie sorgt hier etwa der Kontrast zwischen dem wis-
senschaftlich Gebildeten, dessen Aueres an (tierisches)
vRoBhaare erinnert, der Reduktion des AuGeren der Figur
193 Mann924,5.3
12 3 Aspekte des Ervahlten
auf nur wenige Merkmale und der Andeutung, dass der lei-
tende Mediziner des Sanatoriums die Kranken weniger be-
hhandelt als vielmehr nin seinem Banna halt (was immer das
im einzelnen heiffen mag). Der Effekt einer Charakterisie-
rrung einer fktiven Person in Abwesenheit lisst sich gut an
George Orwells Roman 984 studieren, in dem die Figur des
Big Brothere in Bildern einerseits omniprisent und ande-
rerseits nie wirklich anwesend ist; das wirke sich zum einen
auf die Bedrohlichkeit der Figur aus, zum anderen werden
natitlch auch thematische Aussagen tber die Natur von
Propaganda nahegelegt.*
Zuverldssigheit: Die Figurencharakteristik kann im Kontext
unzuverlissigen Erzihlens stehen und insofern unter-
schiedliche Grade und Typen der Zuverlissigkeit baw. Un
sruverlissigheit aufweisen (s. Kap. 4.4).
~ Kontext: Auch der unmittelbare Kontext, in dem die Figu-
rencharakteristik steht, kann diese becinflussen. Literari-
sche Erzihlungen verftigen oft aber eine komplexe Drama-
turgie, in der es Schhisselszenen wie Konfiikte, einen Show-
down oder aber auch Abschweifungen gibt. So kann
beispielsweise durch einen dramatischen Handlungskon-
text die »Dringlichkeit, d.h. Aufmerksamkeitslenkung, der
Charakterisierung erhéht werden, wahrend eine Charakte~
risierung im Kontext eines lingeren Exkurses unter Um-
stinden dazu fire, dass man der Figur eine cher unwichtige
Rollein der Handlung 2uweist
Komplexe Figurenkonzeptionen
‘Aus den genannten Mitteln und Strukturen der Charakterisie-
rrung entstehen mehr oder weniger komplexe Figurenkonzep-
194 Vel. Orwell1g4o,
432 Fiktive Frethlwelten undihreBewohner 133
tionen, d.h. Weisen, in denen die Figur als ganze angelegt it,
‘und Gesichtspunkte, unter denen diese Konzeptionen beur-
teilbar sind. Sie lassen sich nach unterschiedlichen Gesichts-
punkten klassifizieren:*
~ Komplexitat: Fine Figur kann mehr oder minder komplex
angelegt sein. Kennzeichen von Komplexitit sind w.a. eine
roe Menge von Eigenschaften, die der Figur zugeschrie-
bben werden, aber auch deren Beschaffenheit: So wird eine
fiktive Person, die aber viele Facetten verfigt, von denen ei-
rige zudem als diachron (also im Zeitverlauf) variabel oder
sogar als inkoharent oder inkonsistent erscheinen, vermut-
lich als komplexer wahrgenommen als eine fiktive Person,
bei derall dies nicht der Fall ist. Die Komplexitit einer Figur
ist aber immer eine Frage der Hinsicht (eine fiktive Person
kann in einer Hinsicht als komplex und in einer anderen
Hinsicht als simpel erscheinen), des Grades (jemand oder
etwas kann mehr oder weniger komplex sein), der Ver-
aleichsgrie (verglichen mit Person B kann Person A als
komplex erscheinen, verglichen mit Person C jedoch nicht)
‘und der Urteilsinstanz (aus der Sicht von Person A kann je-
‘mand oder etwas als komplex erscheinen, aus der Sicht von
Person B jedoch nicht). Entsprechend unscharf ist die Kate-
‘gorie und entsprechend vorsichtg ist sie anzuwenden,
~ Realisrus: iguren konnen mehr oder minder realistisch an-
‘gelegt sein, wobei die Kategorie Realismus: allerdings Un-
terschiedliches besagen kann (vgl. den Exkurs am Ende die~
ses Abschnitts,S.140-142). Nach Ederberuht der Realismus
195 Vel. Eder 2008, $.389-399 u.8. Wir weichen von Eders
Darstellung allerdings in einigen Punkten ab und passen sie
wwiederum an lterarsche Figurenkonzeptionen an, Vel. bereits
Forsteri947,5.46f
134 3 Aspektedes Erzahlten
einer Darstellung im wesentlichen auf zwei Elementen,
namlich auf der Erwartbarkeit des Dargestellten und der Ei
wartbarkeit der Darstellungsmittel, Dabei gilt jeweils, dass
die Darstellung mit steigendem Bekanntheitsgrad des Dar-
jgestelten und der Darstellungsmittel als zunchmend reais
tisch eingeschitat wird. Der so verstandene Realismus ist
daher individuell variabel (unterschiedliche Personen kén-
zen unterschiedliche Erwartungen haben und nicht zuletat
‘uber unterschiedliche Welt- bzw. Menschenbilder verfiigen)
‘und auch gruppenspezifisch variabel (zu bestimmten Zeit-
punkten stehen unterschiedliche Darstellungskonventio-
nenzur Verfiigung bew. sind unterschiedliche Darstellungs-
Konventionen verbreitet)#
~ Typisierung/individualisierung: Figurenkonzeptionen kén-
nen mehr oder weniger deutliche Zge einer Typisierung
tragen, d.h., in der Konzeption kann ein bestimmtes Bigen-
schaftsbiindel besonders hervorgehoben oder betont wer-
den. Das bedeutet nicht, dass die der typisierten Figuren-
konzeption entsprechende diegetische Figur nicht auch tiber
sonstige (also untypische) Eigenschaften verfiigen wiirde.
Entscheidend ist, dass auf der Ebene der Darstellung be-
stimmte Figenschaften hervorgehoben werden; so ist bei-
spiclsweise James Bond in Ian Flemings Romanen ein fiir
das Genre durchaus typischer Agent, der abgesehen davon
aber auch noch aber weitere Eigenschaften gewdhnlicher
Personen verfiigt. Entsprechende Typisierungen sind in ho-
hhem Mafe funktional, denn sie rufen bei Rezipienten
schnell einschlagige Wissensbestinde ab, was den vom Text
exforderten Charakterisierungsaufwand reduziert.™ Die Ty-
pisierung einer Figur kann sich u.a. dem Genre oder auch
196 Eder 2008, 8. 382-389,
397 Vel.ebd., $375
32 Filaive Erathlwelten undibre Bewohner 135
‘unserem Alltag (oder zumindest unserer Welt) entnomme-
zen Kategorisierungen verdanken, Sehr gelaufige Fille einer
‘vom Genre abhangigen Typisierung finden sich etwa in
Detektivromanen, in denen sich Kriminelle ung Ermittler
gegeniiberstchen, oder in der Liebesgeschichte, in der die
Liebenden trotzallerlei Verwicklungen schlielich zueinan-
derfinden. Figurenkonzeptionen kénnen sich auch alltags-
‘weltichen Stereotypisierungen verdanken und beispiels-
‘weise Rollenstereotype (»die Hausfrauy, odie femme fatales,
der zerstreute Professors) oder kulturelle, gsellschaftliche
‘oder gender-bezogene Stereotype (nder Auslindere, der Ar-
beitsloser, oder Machor) reproduzieren. Von einer in dieser
‘Sinne )stereotypens Darstellung sprechen wir dann, wenn
das relevante Eigenschaftsbiindel der Figur auf Vorurteilen
Dasiert, anscheinend unkitisch tbernommen wurde oder
latitisch geschen werden sollte.™* Neben der Reproduktion
eines Stereotyps im Rahmen von Figurenkonzeptionen
‘kann ein Erzahltext natitlich auch Typisierungen hinterfra~
igen; in diesem Fall bleibt beispielsweise die Anspielung auf
eine Typisierung bestehen, zentrale Elemente oder Figen-
schaften derselben werden aber nicht reproduziert, db. af-
firmativ oder alternativios dargestellt. Als Gegenpol der Ty-
pisierung kann man die Individualisierung bezeichnen; d.h.
eine Figurenkonzeption, die ganz darauf angelegtist, unver-
‘wechselbare Eigenheiten einer Figur herauszustellen.”* Ty-
pischerweise entsprechen literarische Figuren weder dem
cinen noch dem anderen Pol in Reinform, Sie stellen viel-
mehr Mischformen dar ~ und wo genau eine Typisierung
vorliegt und wo nicht, muss im Zuge einer Analyse heraus-
gestellt werden. Eine wiederum andere Form der Typisie-
198 Vel. Caroll1998, 8.378.
199 Val. Eder 2008,$.229,
136 5 Aspektedes Erzahlten
rng betrift nicht die fiktiven Figenschaften fiktiver Perso-
nen (und die Frage, woher die Kategorien stammen, unter
denen sie erfasst werden kénnen), sondern den Artefakt-
Charakter der Figur baw. typische oder untypische Darstel-
ngsweisen baw. -techniken.*° Hier kann man also beurte!-
Jen, ob die Figurenkonzeption als ganze oder einige ihrer
‘Aspekte innovativ oder konventionell sind, wobei als Ver-
gleichsgrundlage u.a. das Einzelwerk, das Gesamtwerk des
‘Autors, die Gattung oder auch der literaturgeschichtliche
Kontextdienen konnen,
= Bewertung: Teil einer Figurenkonzeption kann eine be-
stimmte Bewertung derselben sein, d-h., eine Figur als gan-
ze kann positiv oder negativ bzw. sympathisch oder unsym-
pathisch gezeichnet sein (sie kann z.B. als Held oder Schurke
angelegt sein) und ihren Rezipienten entsprechende Urteile
‘baw. Rezeptionsweisen nahelegen. Entsprechend eng ver-
Jenipft ist die Bewertung der Figur mit den von uns in Ab-
schnitt.25 diskutierten Funktionen der Figurengestaltung.
= Relevanz fiir die Handlung: Figuren konnen in ihrer Be-
ziehung zur Handlung untersucht werden, Ublich ist bei
spielsweise die Unterscheidung von Haupefiguren, die die
Handlung in entscheidender Weise beeinflussen, und
Nebenfiguren, die dies nicht tun. Auch wird in klassischen
formalistischen und strukturalistischen Modellen zwischen
Protagonisten (Helden) und Antagonisten (Widersachern)
unterschieden (s, Abschn. 325 und Kap. 31.2, §.1080),
~ Dynami: Figuren kénnen eher dynamisch oder eher sta-
tisch angelegt sein, dh., die fiktive Person kann sich im Lau-
fe einer Erzahlung entwickeln oder nicht. Wesentlich fir die
Frage, ob wires in einem bestimmten Fall mit einer eher dy-
ramischen oder cher statischen Figurzu tun haben, sind die
200 Vgl. Eder fu.a] 2010, 5.28.
‘32 Filtive Brathlwelten und ihe Bewohner 197
oben diskutierten dbergreifenden Strukturen der Dichte,
‘Verteilung und Reihenfolge der Charakterisierungen. In ei-
nem weiteren Sinne kann man auch das Bild, das sich Rezi-
pienten im Laufe ihrer Leketire von der Figur machen, auf
seine Dynamik untersuchen:** Zur Konzeption manchet
Figuren gehdrt, dass sich das Bild der Leser von der Figur
im Laufe der Lektiire mehr oder minder radikal andert. Bin
Beispiel wird in Kapitel 4.4, S. 239, diskutiert: In Agatha
Christies Roman Alibi (The Murder of Roger Ackroyd) erfah-
ren Leser erst spit, dass Dr. Sheppard der Mérder ist, und
damit andern sich die der fiktiven Person zugeschriebenen
Eigenschaften radikal.
~ Offenheit/Opazieit: Mie diesen Kategorien soll erfast wer-
den, ob das Innenleben der Figuren geschildert (und somit
‘unmittelbar zuginglich) ist oder nicht Ist das Innenleben
keiner der in einer Erzahltextpassage beschriebenen Figuren
‘uginglich, so ist die Passage extern fokalisiert(s. Kap. 43,
S. 226). Zu beachten ist wiederum, dass aus dem Artefalt-
Charakter der Opazitit nicht folge, dass die in Rede stehende
fiktive Person kein Innenleben hitte; die Kategorie bezieht
sich vielmeht lediglich auf die Frage, ob entsprechende Schil-
derungen Teil der Darstellungsstrategie des Textes sind.
~ Ganaheitichkeit/Fragment-Charakter: Bine ganzheitliche Fi-
ur verfigtiber alle Eigenschaften, die wir Personen norma~
lerweise zuschreiben. Am Schluss von Abschnitt 3.2.2 haben
‘wir aber bereits daraufhingewiesen, dass nicht lle Erzihltex-
te die Vorstellung autorisieren, dass wir es mit tatsichlichen
Personen zu tun haben (und entsprechend eingeschrinkt
sind dann die Moglichkeiten einer diegetischen Figurenana-
lyse). Manche Charaktere sind vielmehr als fragmentarische
ot Vel. Eder 2008, 5.3536
202 Vel. ebd., 5.394
18 3 AepeltedesFrothiten
angelegt und auf einzelne Eigenschaften oder Eigenschafts-
‘inde reduziert (dies beeinffusst dann wiederum den Rea-
lismusder Darstellung, s.S.127 und 140-142)
‘igurenkonstellation: Ein wichtiget Teil der Figurenkonzep-
tion ist die sogenannte \Figurenkonstellations, Erfasst wird
damit die Position und derstellenwert, die bzw. den einzelne
Figuren elativ zu anderen Figuren einnehmen, sowie das ge-
samte System dieser Bezichungen.* Aufallgemeinster Ebe-
ne arbeiten Figuenkonstellationen mit Korrespondenzen
oder Kontrasten* Das bedeutet, dass die Figuren in Hin-
blick auf bestimmte Merkmale als ahnlich oder aber als ver-
schieden konzipiert sind; entsprechend spricht man von Pa~
rallel- oder Kontrastfiguren. Wichtige Vergleichspunkte be-
teffen die Erzahlebene, auf der die Figuren angesiedelt sind
(s. Kap. 33); Aufmerksamkeitshierarchien (Wer ist Haupt,
‘wer Nebenfigur?) und Figurenkonzepte (Welche Figur ist
kkomplexer, realistischer, individueller usw.?). Besonders
vielfiltig sind die Moglichkeiten des Vergleichs zwischen fik-
tiven Personen und ihren Eigenschaften (s. Abschn. 3.2.2)
Interessant sind beispielsweise die Werte oder Wertvorstel-
lungen, fr die die einzelnen Figuren stehen oder die sie ver-
‘meten. MitJens Eder“kann man hier genauer unterscheiden
znwischen der Eindeutigkeit, mit der bestimmte Figuren be~
stimmte Werte vertreten, nimmlich der Zentriertheit (Gibtes
eine Zentralfgur, von deren Werten sich diejenigen der an-
deren Figuren absetzen baw. um die herum sie angeordnet
sind?), der Bandbreite der Werte insgesamt (Wie ist es um
das Wertespektrum der Figuren bestellt? Ahneln sie sich in
ihren Wertvorstellungen mehr oder minder? usw.) sowie
203 Vel ebd, 5. 464-484
204 Vel. Pfister 2001, S. 224-232; Titemann 1993
205 Eder 2008, 5.504; vgl-auch Cartoll2002
432 Fiktive Erathlwelten undihre Bewohner 139
der Abstufimg (Unterscheiden sich die Figuren in Hinblick
auf ihre Werte polar oder graduell?). Weiterhin kann man
priifen, ob die Bezichungen zwischen den Figuren statisch
‘oder dynamisch sind, und zwar wiederum einerseits in Be~
zug auf ihre Darstellungsweise und in Bezug auf die Wahr-
nehmung der Beziehungen durch Rezipienten,
‘Auch diese Liste von Gesichtspunkten zur Beschreibung iber-
agreifender Figurenkonzeptionen ist offen. Deutlich ist zudem,
dass die einzelnen Punkte auf der Liste in vielfachen Beziehun-
gen zueinander stehen. Zum Beispiel ist anzunehmen, dass
sich die Dynamik einer Figurenkonzeption auf deren Komple-
xitit ebenso auswirkt wie auf den Realismus der Darstellung,
‘Welche der Gesichtspunkte fir die Analyse der Figuren eines,
konkreten Erzihltextes brauchbar sind, hingt (natiitlich) von
der Beschaffenheit des in Rede stehenden Textes ab.
Konzeptionen des Realismus narrativer Darstellungen
Die Konzeption von Figuren oder anderen Elementen ei-
nes fiktionalen Erzahltextes als realistisch zu bezeichnen,
ist ebenso geliulig, wie meist unklar bleibt, was srealis-
tisch« eigentlich heifen soll. Den Realismus einer narra-
tiven Darstellung kann man an vielen verschiedenen Ge-
sichtspunkten bemessen, und je nach zugrunde gelegter
Konzeption kann eine bestimmte Eraihlung als mehr
oder weniger realistisch erscheinen. Zu den einschligi-
gen Gesichtspunkten gehoren:
(@) die Frage, wie viel von dem, was in der fktiven Welt
der Fall ist, auch in der Wisklichkeit der Fall ist;
(b) die Frage, wie viel von dem, was in der Wirklichkeit
der Fall ist, auch in der iktiven Welt der Fall ist;
140. 3 Aspektedes Eraihten
(© die Wabrscheinlichkeit, mit der das, wasin derfiktiven,
‘Welt der Fall ist, auch in der Wirklichkeit der Fall ist;
(@) die nomologische (naturgesetaiche) Moglichkeit des-
sen, wasin der fiktiven Welt der Fall ist
(©) die Menge an Informationen tber die Wirklichkeit,
die wir dem Erzahiltext entnehmen kénnen.
Wihrend diesen Gesichtspunkten gemeinsam ist, dass
sie an einer Beziehung zwischen fiktiver Welt und Witk-
lichkeit orientiert sind, greifen andere Realismus-Kon-
zeptionen u.2. auf die folgenden Gesichtspunkte zurick:
(die Anschaulichkeit der Darstellung;
(g) die Vertrautheit mit Darstellungskonventioné
(b) die (Ausgeprigtheit der) Vorstellung ([llusion), man
habe es bei dem Gegenstand einer fiktionalen Dar-
stellungmiteinem wirklichen Gegenstand zu tun.
Ein Beispiel kann verdeutlichen, dassman anhand der ge-
nannten Konzeptionen zu recht unterschiedlichen Ein-
schitzungen desselben Erzihltextes kommen kann: Die
Harry-Potter-Romane von Joanne K. Rowling sind, be-
trachtetman ihre zentraleHandlung, unrealistischim Sin-
ne von (a) und (A), dabeiaber durchausrealistisch im inne
von (f(g) und (h) —und vielleicht auch im Sinne von (b).
Vereinfacht gesagt: Zauberei gibt esnicht in der Witllich-
eit, und sie ist naturgesetalich unméglich; die Darstel-
lung der Zauberei im Roman ist jedoch meist sehr an-
schaulich, sie folgt vertrauten Darstellungskonventionen
und lide Leser 2u der Vorstellung ein, Zauberei sei etwas
véllig Normales. Unklar ist die Einschatzung von (b): Ei-
nerseitsistvielesvon dem, wasin der Wirklichkeit der Fall
ist, auch in der fiktiven Welt der Fall (Harry Potter sieht
‘42 Filtive Ereahlwelten und ihre Bewohner
ut
wie einnormaler Mensch aus und verfiigtibereinen weit-
agehend normalen Charakter, auerdem ist die Welt der
Zauberer eine Art Parallelwelt neben der gewéhnlichen,
usw.);andererseits gibtesin der Wirklichkeit gewisse Na-
tturgesetze, die in der fiktiven Welt der Romane offen-
sichtlichnichtgelten. Auch dieBeurteilungvon ()isenicht
lar; Uber die Welt kann man anhand der Romane wohl
sur auf recht abstrakten Ebenen etwas lernen (beispiels-
wweise: *Mutzahltsich aust); viele konkrete Dinge dagegen
(etwadie Zauberei betreffend) sind niche ibertragbar.
Der Vollstandigkeit halber erwahnen wir an dieser
Stelle auch den von Roland Barthes beobachteten soge-
nannten »Realititseffekte:"* Ausfihrliche Beschreibun-
gen, dienichtder Beférderung der Handlungeines Erzsh-
textes dienen, habennach Barthes den Effekt, die Darstel-
lung realistischer erscheinen 2u lassen. Giltg ist diese
‘Auffassung jedoch wohl nur mie Einschrinkungen (bzw.
in qualifizierter Art und Weise); so kommt es sicherlich
daraufan, was und wie beschrieben wird und ob dabeieta-
bliertenDarstellungskonventionenentsprochen wirdoder
nicht (s. 8.135); zu ausfithrliche Beschreibungen kénnen
(unabhingig davon, ob sie handhingsfunktional sind oder
nicht) auch einen Verfremdungseffekt nach sich zichen.*”
‘Theorien des Realismus narrativer Darstellungenmiis-
sen u.a. kliren, wie genau die genannten Realismus-Be-
{griffe miteinander zusammenhingen und wie sich ihre
Graduierbarkeit sowie ihr (manchmal deutlich) evaluati-
ver Charakter verstindlich machen lassen.’
206 Vel. Barthes 1968,
207 Vel. daru Van Peers986,
208 Fir weiterfihrende Uberlegungen zum Vorstehenden vgl. Walton
1990, S.328-351;2um Begriff in der Philosophie vel. Haack 987
142, 3 Aspekte des Erzihlten
Anhand der elementaren sprachlichen Mittel, der abergrei-
fenden Strukturen der Charakterisierung sowie der Figuren-
konzeptionen entwickeln Leser fiktionaler Erzihltexte ihre
Vorstellungen von den Eigenschaften und Konturen fiktiver
Personen. In Abschnitt 32.6 gehen wirkurzauf kognitionspsy-
chologisch orientierte Forschungen zu diesem Problemzusam-
‘menhang ein, die sogenannten mentalen Modelle.
Hinweisen méchten wir an dieser Stelle abschlieSend auf
cinen Problemzusammenhang, der nicht mur fir Figuren, son-
dern vielmehr fir alle Aspekte des in fiktionalen Texten Dar-
gestellten wichtg ist:®? Kein Ereshltext kann ale Eigenschaf-
ten fiktiver Personen (oder fiktiver Gegenstinde, Situationen,
‘und Sachverhalte allgemein) spezifizieren. Damit ergibt sich
die Frage, was genau in einer fktiven Welt der Fall ist, wenn,
cine explizite (und zuverlissige) Beschreibung des in Rede
stchenden Gegenstands oder Sachverhalts fehlt. Diese Frage
kkénnen wir natirlich einerseits in Bezug auf triviale Sachver-
halte stellen ()Welche Haarfarbe hat Sherlock Holmes?) und
in der Folge getrost vernachlissigen. Andererseits bleiben in
fiktionalen literatischen Texten auch zentrale und wichtige
Aspekte der fiktiven Welt unbestimmt, d.h. solche, mit de-
nen sich Interpreten typischerweise auseinandersetzen. So
‘wurde beispielsweise lange dariiber gestritten, was die Motive
Hamlets sind oder ob Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Erzih-
lung Der Sandmann verrickt ist oder nicht. Die Beantwor-
‘tung dieser Fragen hat einen wesentlichen Einfluss beispiels-
wweise darauf, fr wie realistisch die Texte eingeschitet wer-
den oder wie die Motivstrukeur und Handlung aufzufassen,
sind. Die literaturwissenschaftliche Strémung der Rezepti-
consisthetik hat die 1Unbestimmtheit: fiktiver Welten (bzw.
209. Vgl Reicher 2010.
432 FiltiveEredhlwelten und bre Bewohner 143,
die Leerstllens des Texts) sogar zu einem Grundstin ihrer
Theorie ethoben.**
In Narratologe, Litravurtheorie und philosophischer As-
thetik sind insbesondere die folgenden 2wei Prinzipien zur Be-
antwortung der Frage diskutiert worden, was in einer fktiven
‘Welt der Fall ist. Diese Positionen werden hier in méglichst
allgemeinen Formulierangen wiedergegeben:*
= Das reality principle besagt, dass wir uns bei der iniaginati-
vven Ausgestaltung einer fiktiven Welt an unseren Annah-
‘men tiber unsere Welt orientieren ~es sei denn, der Erzahl-
text besagt ausdriicklich etwas anderes. Ein verwandtes
rinzip ist in der Narratologie auch als principle of minimal
departure populit geworden.
= Das mutual belief principle besagt, dass in einer fiktiven
Welt neben den vom Text explizit benannten auch die Din-
ge der Fall sind, von denen in der Entstehungszeit des Textes
imallgemeinen angenommen warde, dass sie der Fall sind.
Beide Prinzipien haben gewisse Vorziige und bestimmte
Schwiichen, die sie als allgemeingilltige Prinzipien ungeeignet
erscheinen lassen.*® Wir begniigen uns hier mit zwei Gegen-
beispielen: Tauchtin einem Mirchen eine alte Frau mit Schlapp-
hutauf, die ein merkwiirdig riechendes Gebriu in einem Kessel
‘aubereitet, so handelt es sich mit groer Wahrscheinlichkeit
210 Val. Koppe/Winko 2008, Kap. 6.
2an1 Vgl-Zipfel 20, 5.8488,
‘212 Grundlegend st Lewis 1978; val. Ryan 1980.
‘213 Und: Die Tatsache, das in einem fiktonalen Erzahltext ein
Destimamter Satz steht, lt noch nichthinreichend daft, dase in
der liven Weleder Falls, was de Satz besagt- Der Satz kann,
‘nimlich im Kontext des unzuverlissigen Erzdhlensstehen und
ierefahend sein (6. Kap. 4.4,5.238f)
144 3 Aspekredes Erzthiten
‘um eine Hexe. Das reality principle wiirde aber etwas anderes
sagen: Da es in der Wirklichkeit keine Hexen gibt, wire die
fragliche Person lediglich jemand, der aussieht wie eine Hexe
im Marchen und sich entsprechend verhalt (vielleicht, weil sie
vorhat, auf einen Maskenball zu gehen). Auch geen das mu-
tual belief principle lassen sich leicht Gegenbeispiele anfihen:
So kénnen wir etwa annehmen, dass Personen, die in einer
(unter realistischen Darstellungskonventionen konstruierten)
fiktiven Welt leben, dber ungefihr dieselben kérperlichen
Merkmale verfiigen wie wir; eben diese Annahme ist aber un-
vereinbar mit dem mutual belief principle, wenn es sich um.
‘Annahmen tiber Meriamale handelt, die zur Entstehungszeit,
des Textes unbekennt waren (etwa: dass wir eine bestimmte
sgenetische Ausstattung haben). Wirstehen damit vor dem wi-
derspriichlichen Befund, dass wir einerseits annehmen sollen,
die fktive Welt sei von fiktiven rwirklichen« Personen bevil-
ss andererseits aber nicht der Fall sein kann *>
Die Suche nach allgemeingiltigen Prinzipien, anhand derer
sich einwandfreifeststellen list, wasiin einer fiktiven Welt der
Fal ist, gilt heute gemeinhin als gescheitert. Neben Welewis-
sen ist auch Wissen aber Genres, Darstellungskonventionen.
usw. ndtig, wenn man herausfinden méchte, was in einer fkti-
vven Welt der Fall ist." Besonders wichtig ist beispielsweise all-
gemeines Wissen tiber psychologische Sachverhalte, das fir
die Charakterisierang der Figur, Erklirung von Handlungen,
und die Klassifikation von Handlungstypen erforderlich ist
(6. Kap. 2und 32)
Bei der Beantwortung der Frage, was in einer bestimmten
fiktiven Welt der Fall ist, verlisst man ~ der oben entwickeleen
214 Vel. Walton 1990, 261
215 Vel. ebd., Kap. 4; 2ur Einfhrung vg. auch New 1999, $.208-114.
216 Vel. Walton 1990, $. 169,
132 Filsive Erzdhlwelten undibre Bewohner 145
Konzeption von Narratologie entsprechend (vgl. Kap. 13) ~ das
Feld der narratologischen Analyse im engeren Sinne und be-
‘gibt sich auf das Gebiet einerallgemeineren Interpretation des
Erzihltextes. Das Beispiel der Feststellung der Eigenschaften
‘von Figuren zeigt aber, wie eng Analyse und Interpretation
miteinander verzahnt sind.
32.4 Figuren als Bedeutungstriiger
Figuren kénnen, wie anderen Aspekten eines (literarischen)
Erzihltextes auch, Bedeutungen zugesprochen werden, was
heift, dass die Figuren fir etwas stehen oder auf etwas ver~
‘weisen; Eder spricht in diesem Sinne von der Figur als Sym-
bol” Wir gehen hier nur kurz.auf diesen Problemzusammen-
hhang ein, weil die Feststellung der Bedeutungen von Figuren
ttber den Kernbereich der narratologischen Analyse, wie er in
Kap. 1g bestimmt wurde, hinausgeht; die Unterscheidung ver-
schiedener Bedeutungskonzeptionen (im Hinblick auf Texte
coder Textelemente) ist in erster Linie Sache der Interpreta-
tionstheorie."*
Fir was stehen oder auf was verweisen Figuren? Diese Frage
kann hier natirich niche durch das Aufzahlen aller Bedeutun-
gen beantwortet werden, die Figuren zugeordnet werden kén-
nen (denn das hiee, alle Erzshltexte zu interpretieren). Wir
iiissen uns mit einigen generelleren Aussagen begniigen:
Figuren knnen erstens auf thematische Aussagen verwei-
sen; diesist eine besonders iibliche Weise, von der Bedeutungt
einer lingeren Textpassage oder eines ganzen Textes zu spre-
chen. Typischerweise betrifft ein solches Thema allgemeine
217 Vgl-Eder 2008, S.5236.
218 Vel. indt/Képpe 2008.
219 Vel. Beardsley981,S.401-409;5.auchS. m6,
148 3 Aspelte des Erzthlen
menschliche (bzw. allgemeinmenschliche) Eigenschaften. So
steht beispielsweise Joachim von Pasenow im ersten Teil von
Hermann Brochs Die Schlafioandler fir die Schwierigkeiten,
die es mit sich bringt, wenn man sich an tberkommenen
‘Wertvorstellungen festiammert.*°
Bine besonders verbreitete Verweisungsrelation ist zwei-
tens die Exemplifixation. Nach Goodman liegt eine Exemplifi-
lation (vereinfache gesage) genau dann vor, wenn ein Gegen-
stand eine Eigenschaft zugleich besitet und auf sie verweist
(genauer: wenn ein Eigenschaftspridikat auf den Gegenstand
zutrifft und der Gegenstand auf das Pridikat verweist)* Ein’
cinfaches Beispiel daft ist eine Stoffprobe, die eine bestimm-
te Farbe einerseits hat und andererseits (als Probe) auf diese
Farbe verweist. Auch literarische Figuren kénnen in diesem.
Sinne iber Eigenschaften verfiigen, auf die sie zugleich ver-
wweisen: Detlev Spinell aus Thomas Manns Erzihlung Tristan
{st ein lebensunttichtiger Kiinstler und steht 2ugleich fir den
‘Typus des lebensuntichtigen Kiinstlers; Meursault aus Albert
Camus’ Der Fremde zeichnet sich durch seine umfassende In-
differenz. aus und stehe (zumindest manchen Interpretatio-
nen zufolge) fir den indifferenten existentialistischen Helden
(c.auch Abschn. 327).
{In extremen Fallen spricht man drittens auch von einer Per-
sonifikation oder Allegorie: Hier steht die Figur fir ein ab-
straktes Eigenschaftsbiindel™ Beispicle dafiir sind etwa Fa-
bbelwesen, die fiir Habgier, Neid oder Schliue stehen, In man-
chen Fillen ist dann der diegetische Aspekt der Figur (é.h.
ihre Zeichnung und Rolle als fiktives Wesen) sehr ei
schrinkt (s. Abschn, 32.2) und die Figurenkonzeption eindi-
1220 Vel Koppe 2008, $.138f
221 Vel. Goodman 1998, 8. 59-65,
222 Vel Plister2001,5.244.
432 Five Frzthlwelten undihre Bewohner 147
‘mensional auf das Anzeigen bestimmter Bedeutungen ange-
lege.
‘Die esctelng von Bedeutungen (Verwesungselionen)
erfordere Interpretations- baw. Abstraktionsschrtte, und es
stellt sich die Frage, wan genau jemand recht hat, der einer
‘gur (oder einem sonstigen Aspekt eines Erzahltextes) eine be-
stimmte Bedeutung 2uschreibt. In der Interpretationstheorie
xonkurrieren verschiedene Bedeutungstheorien miteinander,
die beanspruchen, diese Frage zu beantworten. Man kann bei-
spielsweise argumentieren,
~ dass ein Textelement iiber Bedeutung X verfigt, wenn der
Autor mit dem Textelement zu verstehen geben wollte, dass
X; bezeichnet wird diese Position als vstarker Intentiona-
lismuse;**
~ dass ein Textelement tiber Bedeutung X verfigt, wenn eine
plausible Interpretation 2u dem Schluss kommt, dass der
‘Autor mit dem Textelement zu verstehen geben wollte, dass
X; Dezeichnet wird diese Position als yhypothetischer In-
‘entionalismuse;**
= dass ein Textelement ber Bedeutung X verfiigt, wenn die
‘beste mégliche Interpretation zu dem Schluss kommt, dass
das Textelement X bedeutet.»*
Diese Bedeutungskonzeptionen kénnen im Binzelfall 2u un-
terschiedlichen Bedeutungszuschrefbungen fihren, und sie
legen ein je eigenes Set von Interpretationsstandards nahe,
4h, die Kriterien variieren, anhand derer man die Korrektheit
ciner Interpretation erkennen kann,
223 Vgl-Stecker 2008.
1224 Val. Levinson 2002,
225 Vel. String 20u.
148 3 Aspelte des Erethlten
325 Funktionen der Figurengestaltung
Eine besonders wichtige Funktion von Figuren in narrativen
TTexten ist die Handlungsmotivation. Anlisslich der Einfih-
rung des Plot-Begriffs wurde bereits darauf hingewiesen, dass
wwesentliche Ereignisse eines komplexen Erzahlwerkes (etwa
eines Romans) in aller Regel durch das Handeln von Figuren
herbeigefithrt werden. Ein Verstindnis der Figuren und ihrer
Motive ist damit zentral auch fiir die Handlungsanalyse eines
Erzihltextes (s. Kap. 2.4,S.102, und 31S, 103f). So kénnen wir
von den durch Figuren herbeigefihrten Ereignissen fragen,
warum sie stattgefunden haben. Der in Abschnitt 32.1 vor
genommenen Unterscheidung von internem und externem
Standpunkt entsprechend kénnen wir als Antworten auf sol-
che Warum-Fragen zwei verschiedene Typen von Erklirungen,
anfihren:*
= Man kann vom internen Standpunkt aus fragen, welche
Griinde oder Motive die fiktive Person hatte, wie sich die
Handlung in das Gesamtbild ihres motivationalen Haus-
halts einfigt, welche Wiinsche oder auch Zwange sie ver
lasst haben, usw. Unter den Bedingungen einer reali
schen Darstellungskonvention kénnen wir an dieser Stelle
alle Erklirungen und Eridirungsmuster anfidhren,, die wir
auch auf das Handeln realer Personen anwenden.* Entspre-
chend vielfaltig sind die Weisen, auf die man die Motivati-
onstypen Klassifizieren kann. Finer Typologie von Lubomir
Dole¥el folgend, lann man beispielsweise unterscheiden
zwischen rationalem Handeln (der Handelnde ist durch
Motive bestimmt, die einer rationalen Uberpritfung stand-
226 Vel. Curtie 2007; Eder 2008,8. 4306,
237 Vel. Steinfath 2001.
432 Filtive Erethlwelten undihreBewobner 149
halten), impulsive Handeln (der Handelnde ist durch Re-
flexe, Triebe 0.3. motivier),akratischem Handeln (der Han-
delnde tut etwas wider besseres Wissen) und irrationalem
‘Handeln (der Handelnde ist mur minimal ~ oder im. Ex-
tremfall des Wahnsinns gar nicht mehr ~ durch rationales
Uberlegen bestimmt). Weiterhin kann man fragen, ob
das Handein cher habituell oder eher situativ bestimmt ist,
‘ob die Motive dem Handelnden vollstindig klar sind, wie er
selbst 2u seinen Motiven steht, d.h., ob er sie begriiBt oder
ablehnt, usw.
= Auch vom externen Standpunkt aus kénnen wir Handlun-
gen von Figuren erkliren, indem wir sie als motiviert auffas-
sen; entscheidend sind hier aber nicht die Motive fiktiver
Personen, sondern vielmehr die Motive der Autoren der
‘Texte, de die Handlungen der Figuren in bestimmter Weise
gestaltet haben, um bestimmte Zwecke zu erfillen. Das Feld
dieser Zwecke ist wiederum weit: Jens Eder unterscheidet
dramaturgische Funktionen oder Genre-Vorgaben (eine Fi-
ggur handele in bestimmter Weise, um einem Plot-Muster
‘oder Genre-Vorgaben gerecht zu werden); soziale oder
rmediale (Stereo-)Typen (eine Figur handelt in bestimamter
‘Weise, weil Leser dieses Verhalten von einer entsprechen-
den Person oder Figur erwarten); hognitive oder affektive
‘Wirkungen (cine Figur handelt in bestimamter Weise, etwa
eerie Redang far Leow lreeseaner oder spamiender
za machen); Anspielung auf reale oder intertextuelle Vor-
bilder (das Verhalten der Figur ist an das Verhalten anderer
Figuren oder realer Personen angelehnt). Diese Liste ist of-
fens
228 Vgl.Dolefel1998,8.70-72.
1229 Eder2008,5. 4301; vel. Jannidis 2004, Kap. 63.
50 3 Aspekte des Erzihlten
Handlungserklirungen, die sich dem externen Stanépunkt
verdanken, sehen den fiktiven Personen selbst natilich niche
zr Verftigung; solche Erklirungen bezichen sich auf den Ar-
tefakt-Charakter fiktionaler Erzthlungen, der sich nur uns,
den Hérern oder Lesern der Erzahlung, darbietet. (Scheinbare
Ausnahmen, sogenannte Metalepsen, werden hier in Kap. 33,
S.178, behandelt.) Beim Lesen oder Horen einer fiktionalen Er-
zahlung kann man, wie unter 32.1 dargestellt, zwischen dem
{nternen und dem externen Standpunkt hin-und herwechseln
und dementsprechend beide Formen der Handlungserklarung
berticksichtigen, (Tatsichlich istes sinnvoll2u fordern, dass ei-
ne umfassende Motivations- baw. Handlungserklirung beide
Formen bericksichtigt) Da es sich um grundsitzich verschie-
dene ‘Typen von Erklirungen handelt, empfichle sich auch eine
terminologische Unterscheidung. Wir schlagen vor, im Fall der
Erklénang der Figurenhandlungen vom internen Standpunkt
von dervinternen Motivierunge und im Fall der Erklirung vom
cextemen Standpunkt von der vexternen Motivierungw zu spre-
chen”
‘Weitere Funktionen der Figurengestaltung sollen hier nur
knapp benannt werden, da sie zum groen Teil bereits an an-
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Panne Bei Abitur-PrüfungenDocument1 pagePanne Bei Abitur-PrüfungenTom GründorfNo ratings yet
- Das ColosseumDocument22 pagesDas ColosseumTom GründorfNo ratings yet
- Axe 5.1 (Vocabulaire)Document1 pageAxe 5.1 (Vocabulaire)Tom GründorfNo ratings yet
- Martin PowerpointDocument26 pagesMartin PowerpointTom GründorfNo ratings yet
- Hamacher - Aspekte Der DramenanalyseDocument20 pagesHamacher - Aspekte Der DramenanalyseTom GründorfNo ratings yet
- Romane Englisches MittelalterDocument4 pagesRomane Englisches MittelalterTom GründorfNo ratings yet
- Kuchen Und DessertsDocument16 pagesKuchen Und DessertsTom Gründorf0% (1)
- Burdorf, D. Gedichtanalyse 1997Document86 pagesBurdorf, D. Gedichtanalyse 1997Tom GründorfNo ratings yet
- Cahiers PédagogiquesDocument5 pagesCahiers PédagogiquesTom GründorfNo ratings yet
- Grundzüge Der Literaturwissenschaft (Mueller-Dyes)Document15 pagesGrundzüge Der Literaturwissenschaft (Mueller-Dyes)Tom GründorfNo ratings yet
- Horn, E. Subjektivität in Der Lyrik 1995Document10 pagesHorn, E. Subjektivität in Der Lyrik 1995Tom GründorfNo ratings yet
- Poetik (Jakobson)Document22 pagesPoetik (Jakobson)Tom GründorfNo ratings yet
- Literaturwissenschaft (Klausnitzer)Document11 pagesLiteraturwissenschaft (Klausnitzer)Tom GründorfNo ratings yet
- Crébillon - Le Sopha, IDocument183 pagesCrébillon - Le Sopha, ITom GründorfNo ratings yet
- (21966850 - Militärgeschichtliche Zeitschrift) Moderner Krieg Gegen Den Alten Feind - Die Eisenbahnen Im Deutsch-Französischen Krieg 1870 - 71Document28 pages(21966850 - Militärgeschichtliche Zeitschrift) Moderner Krieg Gegen Den Alten Feind - Die Eisenbahnen Im Deutsch-Französischen Krieg 1870 - 71Tom GründorfNo ratings yet
- Torquato TassoDocument1 pageTorquato TassoTom GründorfNo ratings yet
- Systematisierung - Aristoteles, Poetik (I-X)Document1 pageSystematisierung - Aristoteles, Poetik (I-X)Tom GründorfNo ratings yet
- Le Génitif en AllemandDocument8 pagesLe Génitif en AllemandTom GründorfNo ratings yet
- Zum Verhältnis Von Geschriebener Und Gesprochener Sprache Im FrühneuhochdeutschenDocument19 pagesZum Verhältnis Von Geschriebener Und Gesprochener Sprache Im FrühneuhochdeutschenTom GründorfNo ratings yet
- Trois Conceptions de La MoraleDocument1 pageTrois Conceptions de La MoraleTom GründorfNo ratings yet
- Le Paysan Parvenu (Commentaire de Texte)Document3 pagesLe Paysan Parvenu (Commentaire de Texte)Tom GründorfNo ratings yet
- "Die Schmach Des Jahrhunderts" (Kurt Hiller)Document6 pages"Die Schmach Des Jahrhunderts" (Kurt Hiller)Tom GründorfNo ratings yet