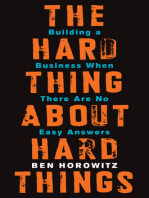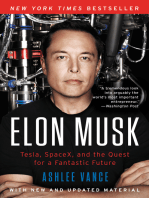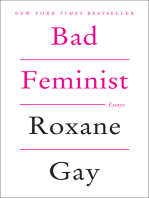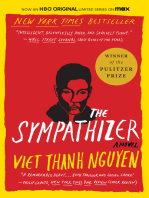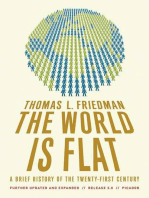Professional Documents
Culture Documents
Peters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'
Peters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'
Uploaded by
antonio rincon nuñez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views31 pagesPeters Heines ‘Bimini, Baudelaire ‘VOYAGE’’
Original Title
PETERS HEINES 'BIMINI, BAUDELAIRE 'VOYAGE'
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPeters Heines ‘Bimini, Baudelaire ‘VOYAGE’’
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views31 pagesPeters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'
Peters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'
Uploaded by
antonio rincon nuñezPeters Heines ‘Bimini, Baudelaire ‘VOYAGE’’
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 31
Paul Peters
Die Modernen vor den letzten Dingen:
Heines Bimini, Baudelaires Voyage
Der Tod ist der letzte Aberglaube“
H. Heine
Sowohl Baudelaire als auch Heine huldigten einer poetischen
Lehre von den Korrespondenzen; und gerade das Verhiiltnis
Heine-Baudelaire ist gekennzeichnet von solchen Korrespon-
denzen. Das fangt an bei der Lehre von den Korrespondenzen
selbst, von den geheimnisvollen, erst durch den Dichter aufspiir-
baren Entsprechungen zwischen duBerer und innerer Welt, je-
nem ‘Surnaturalisme’, den Baudelaire aus der Kunstkritik Hei-
nes iibernahm und, mit unabsehbaren Folgen, in die franzésische
Poetik einfiihrte. Es geht iiber das Wort ,,Modernitat", das man
lange fiir eine Baudelaireische Wortprigung hielt, bis man auf
Heines Gebrauch just dieses Wortes in den Reisebildern stieB.
Es betrifft natiirlich auch das Phinomen Paris, wo Heine und
Baudelaire ungefihr um die gleiche Zeit mit ihrer iiberspannten
lyrischen Sensibilitit die Verwerfungen und Erschiitterungen,
welche die Erfahrung Grofstadt mit sich brachte, zu registrieren
anfingen.' Aber die seltsamste Korrespondenz, die zwischen
diesen beiden Dichtern obwaltet, ist wohl die folgende: Im Le-
ben sind die beiden, so viel wir wissen, sich nie begegnet; dafiir
aber im Tode, an der Schwelle des Todes. Correspondance
étrange: Und in der Tat mutet es fast wie ein mystisches Entspre-
Heines Werke werden zitiert nach der Diisseldorfer Heine-Ausgabe (DHA). heraus-
gegeben von Manfred Windfubr, Hamburg 1973ff; Baudelaires nach der Ausgabe der
Pléiade, herausgegeben von Claude Pichois, Euvres Completes, Paris 1961. Zum
surnaturatisme/Supranaturalismus vgl. DHA XI, 25 und CEuvres, 890; zur Moder-
nitaUmodernité vgl. DHA VI, 161 und Guvres, 11631". Zum Verhaltnis Hei-
ne/Baudelaire vgl. Kurt Weinberg, Romantique defroqué. Henri Heine Héraut du
Symbolisme francais, New Haven — Paris 1954; Oliver Boeck, Heines Nachwirkung
und Heine-Parallelen in der franzésischen Dichtung. Gdppingen 1972; Dolf Oehler.
Pariser Bilder I (1830-1848) Antibourgeoise Asthetik bei Baudelaire. Daumier und
Heine, Frankfurt a. M. 1979; sowie ders... Ein Héllensturz der Alten Welt, Frankfurt a
M. 1988. +
125
chungs- und Korrespondenzverhiiltnis an, daB das groBe Ge-
dicht, Le Voyage, welches die einzige, dafir aber epochema-
chende Gedichtsammlung Baudelaires, Les Fleurs du Mal, be-
schlieBt, sowie das gewaltige posthume Fragment Bimini, das
von den Kommentaren und Herausgebern vollig zu Recht als die
Summe des Heineschen Werkes betrachtet wird, beide ein und
dasselbe Thema haben: die Reise in den Tod.
IL
Dieser Umstand ist um so bemerkenswerter, als beide Dichter
ein tuuBerst gebrochenes Verhiiltnis zu jener Natur haben, welche
wir die erste nennen. ,.Die Natur sah ich mit Ungeduld™, schreibt
Brecht, aber selbst die Brechtsche Ungeduld angesichts der Na-
tur nimmt sich bescheiden aus vor dem blasierten Achselzucken,
das etwa ein Heine noch den erhabensten Naturschauspielen
bisweilen entgegenbringt. Rufen wir das klassische Beispiel
solcher Abfertigung des deutschen Naturkults kurz in Erinne-
rung:
Das Friulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang.
Es rthrte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Friulein! seyn Sie munter
Es ist ein altes Stick;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zuriick.
Kritik der Sonne und des Friuleins: Zwar hat Karl Kraus dazu
noch gemeint, daB der Dichter solche Despektierlichkeiten bes-
ser unterlassen hatte, nicht wegen der Dame, sondern wegen des
Sonnenuntergangs.' Aber Heines Gedicht visiert schon beide:
Bimini, DHA IVI, 36Mf; Le Voage, Euvres, 1221, Wolfgang Preisendanz hat
imeines Wissens als erster auf die tiefen und grundiegenden Korrespondenzen z2wi-
schen diesen beiden Texten hingewiesen, Vgl. sein Heinrich Heine (Munchen 1983),
S.171
DHA I, 35f,
Karl Kraus, Werke VIII, Munchen 1960, S. 205.
126
Und so unerbittlich er das Friiulein in ihren banalen Anwandlun-
gen auch persiflieren mag, sie, und nicht der sublime Himmels-
k@rper, ist jetzt Thema: In der Heineschen antikopernikanischen
Revolution kreist das Gedicht jetzt um das Friulein und nicht
um die Sonne. Und so ironisch er die Dame wohl auch sieht, so
unendlich hat er sie erh6ht, indem er sie in jedem Sinne noch
vor" dem majestitischen Himmelskérper setzt, wobei solche
Erhhung auch freilich als eine weitere Persiflage, und vielleicht
noch die perfideste, zu verstehen ist. Aber die Hyperbel ist
gleichzeitig auch tédlich ernst gemeint; und die Sonne wird auch
durchaus davon getroffen, wie Kraus mit feindlichem Gespir
ganz richtig da herausgehért hat.
Mit anderen Worten: Was wir auf dem kleinen Raum dieses
Gedichts so schockhaft erleben, ist nichts weniger als der Sturz
der ersten Natur. Sie dankt ab zugunsten der zweiten, eine epo-
chale Verschiebung, die an unzihligen Stellen von Heines Werk
durchexerziert wird, wenn auch nicht immer mit ganz so bravou-
réser Durchschlagskraft wie hier. Denn daB Heine gerade die
Sonne zur Folie des Frauleins wahit, zeigt, wie sehr er hier aufs
Ganze geht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind nicht
bloB erhabenes Naturschauspiel, sie stehen — so der Mythenfor-
scher Frobenit am Ursprung von Naturreligion und mythi-
schem BewuBtsein Uberhaupt.’ Vor deren majestitischer Ver-
kérperung ‘erster’ Natur setzt Heine jedoch das Primat der
zweiten, von Geschichte und Gesellschaft, gerade in einem ihrer
banalsten Exemplare. Insofern ist die Despektierlichkeit gegen-
ber der Sonne hier in der Tat noch ungeheuerlicher als die De-
spektiertichksit gegeniiber dem Friulein.
ic ist ndtig, denn Heine, aus der deutschen, Goetheschen
Tea ition Kommend, muB sich — trotz Hegel — in der Lyrik vom
Primat der ersten Natur noch freikiimpfen. Das hat er dann auch
mit letzter Konsequenz getan. Wihrend die deutsche Lyrik noch
gut ein Jahrhundert fest im Bannkreis der Quetschgen-, Maika-
fer-, Lerchen- und Wachteln-Besingung gefangen blieb, eman-
zipierte sich Heine grundlegend von dieser:
Leo Frobenius zit. nach Kurt Hubner, Die Wahrheit des Mythos, Munchen 1985, S.
SI
127
ach, die Sterne
Sind am schénsten in Paris,
Wenn sie dort, des Winterabends,
In dem StraBenkoth sich spiegein.”
Das lit an Deutlichkeit dann nichts zu wiinschen iibrig. Paris
hat Vorrang vor den Sternen. Und wenn die Sterne noch iiber-
haupt zum Vorschein kommen, so kénnen sie ja, wie alles ande-
re, nur im Medium der Metropole, der ,,Hauptstadt des Jahrhun-
derts", so richtig aufleuchten
Das ist bereits die Welt von Baudelaire: die Natur durch das
Medium von Paris gesehen und einzig in diesem Medium auf-
leuchtend, dafir aber in ungeahnten Schattierungen und Bre-
chungen. So sieht auch Baudelaire in der ,.Landschaft*, im Pay-
sage von Paris, Himmel und Gestirne:
Je verrai l’atclier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mits de la cité,
Et les grands ciels qui font réver d’éternité.
Hest doux, a travers les brumes, de voir naitre
L*étoile dans I’azur, la lampe a la fenétre,
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pile enchantement.
Nicht zufallig haben viele Eigentiimlichkeiten des unbefange-
nen Heineschen Umgangs mit der Natur, sei es mit dem Meer,
den Sternen oder mit der Sonne, gerade in der franzésischen
Lyrik eine groBe Wirkung entfalten kénnen, wahrend ihre Inno-
vationskraft der deutschen Lyrik, mit ihrer spréden und devoten
Naturanbetung, zuniichst verschlossen blieb. In Frankreich, in
Paris, hatte man schon eher Sinn fir Heines ,,Befreiungsschlag*
gegen die erste Natur, gegen alle auratische Ergriffenheit vor ihr.
Damit wurden unzahlige im starren romantischen Naturkult
eingebundene Topoi wieder losgelést und emanzipiert. Dies
ibrigens auch dann, wenn die Stadt als solche gar nicht priisent
ist. Denn auch in der freien Natur stehen Heine und Baudelaire
als Stidter dar. Wenn Baudelaire zum Beispiel in L’homme et la
mer am Meeresufer steht, so tut er dies auf eine Weise, die ohne
DHA IV, 17
Euvres, 78,
128
Heines Nordsee-Gedichte und ihre franzésische Rezeption wohl
nicht denkbar ware: nimlich das ,ozeanische GefiihI", das ihn
dort iiberkommt, ist die Ergriffenheit vor dem eigenen Inneren,
vor den eigenen Abgriinden und verborgenen Reichtiimern, vor
der eigenen Welt, von der ihm das Meer in seiner ethabenen
Ungestiimheit nurmehr die willkommene Spiegelung bietet.’ Es
ist mit anderen Worten weniger das Meer, das den Poeten, als
der Poet, der das Meer hier iiberwaltigt. Und ahnlich ergeht es
der Sonne. In Heines Wintermdrchen wird sie geradezu kumpel-
haft personifiziert und gleichsam mitleidig, von gleich zu gleich,
angesprochen:
Die Sonne ging auf bey Paderborn,
Mit sehr verdross’ner Gebehrde,
Sie treibt in der That ein verdrieBlich Geschaift —
Beleuchten die dumme Erde!
Und in verwandter, wenn etwas vornehmerer kollegialer Per-
sonifizierung — Baudelaire war ja Dandy — geht die Sonne, im
Gedicht Le soleil, ,,le long du vieux faubourg™ spazieren, um ein
uhnliches, vielleicht etwas dankbareres, jedoch ebenfalls zwei-
felhaftes Geschiift zu betreiben, und, wenn nicht gleich Pader-
born, so immerhin die Stadt Paris zu beleuchten:"
i qu’un poste, il descend dans les villes,
le sort des choses les plus vil
Et s‘introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hOpitaux et dans tous les palais.
Die bei Heine implizite Verwandtschaft von Dichter und Son-
ne — in der gemeinsamen Aufgabe, die Welt zu erhellen — wird
bei Baudelaire also explizit. Den neuen, kollegialen Umgang mit
der Sonne teilen die beiden Dichter indes allemal.
Bei aller Ahnlichkeit solchen Umgangs mit der Natur gibt es
zwischen Heine und Baudelaire jedoch gleichzeitig auffallende,
Euvres, 18, Vgl. dazu auch Boeck, a.a.0., S. 194fF, An dieser Stelle wiire auch die
Vermittlertitigkeit Gérard de Nervals zu nennen, der als Kritiker und Ubersetzer das
Bild des Lyrikers Heine in Frankreich wesentlich prigte.
DHA IY, 118,
ures, 79,
129
gewichtige Differenzen. Sie betreffen yor allem den unter-
schiedlichen Stellenwert jener spannungsvollen Uberlagerung
von erster und zweiter Natur, die wir bei beiden Dichtern fest-
stellen kiénnen. Bei Heine besteht diese Spannung eher in der
Kluft, in der Schere zwischen erster und zweiter Natur. Denn
gerade in der Schere zwischen diesen beiden erblickt Heine die
Chance. Denn was ist fiir ihn die — erste — Natur? Sie ist vor
allem der zyklische Kreislauf von Geburt und Tod, der mit sei-
ner ,,Vergeblichkeitsstruktur* auch die menschliche Geschichte
einzuholen droht und der in dem mythischen BewuBtsein der
Wiederholung des Immerwiedergleichen festgeschrieben wird.
Daraus méchte Heine um jeden Preis herausbrechen, um die
Moglichkeit eines originellen Geschichtsentwurfs zu vindizie-
ren. Heines eigene Aussagen dazu sind iibrigens gekennzeichnet
durch schier unauflésbare Spannungen. In dem zentralen Text
Heines zur Verschiedenartigen Geschichtsauffassung bleibt der
Streit zwischen den beiden gegensiitzlichen Geschichtsmodellen,
dem zyklischen und dem progressiven, ganz in der Schwebe
hangen, unentschieden, unauflésbar.'' Heines Kritik an der Son-
ne — als dem naturmythischen Ursprung — betrifft ja gerade ihre
Versklavung, daB auch sie sich nicht aus dem mythischen Bann
des Wiederholungszwangs zu lésen vermag. Dadurch ist ihre
Arbeit der Beleuchtung bloB voriibergehend und damit — wie die
‘lichtbringende’ des Dichters — wohl vergeblich:
Hat sie die eine Seite erhellt,
Und bringt sie mit strahlender Eile
Der ander ihr Licht, so verdunkelt schon
Sich jene mittlerweile.
Der Stein entrollt dem Sysiphus,
Der Danaiden Tonne
Wird nie gefullt, und den Erdenball
Beleuchtet vergeblich die Sonne!
Wohl am durchschlagendsten manifestiert sich diese Span-
nung bei Heine, diese Zerrissenheit zwischen triiber Ahnung
eines mythischen, zyklischen Verhiingnisses und der Hoffnung
DHA X. 301
DHA IV, 118,
130
auf den Durchbruch zu einem progressiven Geschichtsablauf, an
dem Schnittpunkt, an dem Scheideweg seiner Karriere: in dem
Helgoliinder Tagebuch, kurz vor dem Entschlu8 zur Ubersied-
lung nach Frankreich. Die Welt bleibt, nicht im starren Still-
stand, aber im erfolglosesten Kreislauf... Auch die Menschheit
bewegt sich nach den Gesetzen von Ebb und Fluth, und viel-
leicht auch auf die Geisterwelt bt der Mond seine siderischen
Einflusse.--" In solche melancholischen Betrachtungen platzt
dann die Nachricht von der Juli-Revolution in Paris: Fort ist
meine Sehnsucht nach Ruhe.“'’ Heine begibt sich nach Frank-
reich, dem Land der ‘Bewegung’ und der Revolutionen, zwei-
fellos, weil er gerade dort die beste Méglichkeit eines Durch-
bruchs zur Geschichte" erblickt.
Uber derartige Hoffnungen hitte Baudelaire wohl nur bitter
lichein kOnnen. Bei ihm hat sich jene Schere, die sich fiir Heine
zwischen erster und zweiter Natur vielversprechend auftat, wie-
der zugeklappt. Bei ihm existieren erste und zweite Natur weni-
ger in der Spannung, als in der Uberlagerung. Sie greifen nicht
nur ineinander, sie gehen ineinander iiber. Fir Heine steht die
Stadt gegen die Natur, wie die moderne franzésische Geschichte
und Gesellschaft gegen den Mythos stehen. Fur Baudelaire aber
ist Paris gleichsam schon Natur, wie die Moderne bereits zum
Mythos, d.h. zur verfestigten mythischen Struktur des Immer-
wiedergleichen geworden. Die zweite Natur hat gegeniiber der
ersten zwar den Sieg davongetragen, aber nur, um zum ihnlich
diktatorischen, ahnlich unerbittlichen und unentrinnbaren Ver-
hingnis sich aufzuwerfen; die Offnung zur Geschichte”
d.h, zu einem emanzipatorischen geschichtlichen Entwurf, ist
wieder einmal auf ewig vertagt worden. Diese unterschiedliche
Haltung ist wohl auf zwei Griinde zurtickzufuhren. Der erste, so
banal er auch klingen mag, ist einfach der, da8 Baudelaire in
Paris geboren und Heine dorthin zugereist ist. Mag, wie Heine
sagte, der Fisch im Wasser sich wie Heine in Paris gefuhlt ha-
ben: So sehr das Grofstidtische, Mondiine Heines Naturell ent-
sprochen haben mag, so sehr markierte es einen Bruch mit den
patriarchalisch-idyllischen Verhiiltnissen, in denen er im dama-
ligen Deutschland aufgewachsen war. Paris ist fir Heine zu-
DHA XI, 47; 50.
131
nachst Ort des Aufbruchs und Ausbruchs, das Fremde und Hin-
zugekommene, das Andere, ja, gerade das begehrte und ersehnte
Andere. Und diesen Nimbus wird es bei allen kommenden Er-
niichterungen und Enttéuschungen nie ganz einbiien. Fir Bau-
delaire dagegen ist es ein Joch, wie nur das heimatliche Terrain
ein Joch sein kann, zumal in den unsiglich bedriickenden, auch
fiir die damalige Zeit auBerordentlich verbiesterten und dumpf-
biirgerlichen Verhiiltnissen, in die er hineingeboren zu werden
verurteilt war. Gerade diese muBten Baudelaire dann wie ,,Na-
tur* anmuten; noch diirfen wir vergessen, daB es die Zeit der
groBen ,,Stadtindianer“-Romane des Dumas und anderer ist, wo
die Helden sich durch das geheimnisvoll verschlungene Paris
wie die Autochthonen durch den nordamerikanischen Urwald
bewegen: So sehr also schien den Zeitgenossen das labyrinthi-
sche Seine-Babylon bereits zur steinernen, wuchernden Natur zu
werden. Vielleicht noch wichtiger als Geographie und Topogra-
phie ist hier indes die Chronologie, der schlichte Fakt eines po-
litischen wie literarischen Generationswechsels. Der entschei-
dende Schnittpunkt 1848 kommt am Ende der Heineschen, er
kommt zu Beginn der Baudelaireschen produktiven Biographie.
Die epochale Verdisterung der Perspektiven nach der zerschla-
genen Revolution haben beide Dichter freilich bis in die letzte
Konsequenz schmerzhaft bewuBt miterlebt. Vielleicht sogar
noch exponierter als Baudelaires @uvre schreibt sich ja auch
Heines Spiitwerk gerade von diesem Datum her.'* Aber fiir Hei-
ne wird noch in der Enttéuschung die *zweite Natur’ stets jene
Méglichkeit der Offnung zu einem begehrenswerten, ersehnten
Anderen bedeuten, die es um jeden Preis aufrechtzuerhalten gilt:
Fur Baudelaire dagegen ist sie bereits zu einer tbermiichtigen
diktatorischen Front geronnen, die er mit allen Mitteln aufbre-
chen méchte. Die Differenz kommt mitunter auch dadurch zum
Ausdruck, wie die beiden Dichter die zwar weitgehend ver-
fliichtigte, ihnen jedoch als Rest und Spurenelement noch ver-
Hoffnung™ zu substantivieren wissen: Bei Heine ist sie
immerhin der Name eines Schiffs, Esperanza, die, wie
vergeblich, immer noch ins offene Meer sticht; bei Baudelaire
dagegen ist in Spleen IV ,l’Espérance* eine Fledermaus, die
“Val. dazu Ochler, Hollensturz, S. 2394f.
132
hilflos gegen eine Mauer stBt. Diese unterschiedliche politische
Wahrnehmung, diese zugleich geringfigige, jedoch qualitative
Differenz im Grade der Verdiisterung, wird dann, bei aller Ver-
wandtschaft in den Voraussetzungen, in der Folge geradezu
polare Kontraste in der Haltung der beiden Dichter zeitigen.
I
So dann gerade auch — so seltsam es auch klingen mag - in ihrer
Haltung zum Tode. Aber vielleicht ist es auf den zweiten Blick
weniger befremdlich, daB gerade hier leichte Verschiebungen
und Differenzen in dem jeweiligen politischen Hoffnungs- und
Verdiisterungsgrad zu den dramatischsten Umpolungen fihren.
Der Tod, was immer auch er sonst sein mag, ist immer auch ein
MaB des Lebens. Freilich ist er zuniichst auch dieses: die spite
Rache der ersten an der zweiten Natur, wo sie endlich ihre alte
Ubermacht wieder mit voller Wucht behaupten kann. Als solche
wird sie dann auch von Heine wie Baudelaire wahrgenommen —
jedoch bei geradezu entgegengesetztem Vorzeichen.
Der Tod kommt schon beim jungen Heine erstaunlich oft vor.
So schreibt er beispielsweise nach seiner Promotionsfeier 1825
dem Jugendfreund Moser: ,,Gestern habe ich den ganzen Tag
mit Briefschreiben an meine Familie und Gratulirt-werden ver-
trédelt; und heute bin ich todt.“ Und setzt beruhigend hinzu:
»Erschrick nicht iiber letztere Worte, ich sprach bloB im figiirli-
chen Sinn.“'* Und so sehr Heine, als Allegoriker der biirger!
chen Gesellschaft, wie jeder Allegoriker im Buch der Lieder den
»Tod“ auch gerne einsetzt — wie wenn er sich zur toten Gelieb-
Grab legt, das ,,Grab“ in Gestalt des Verlusts der Ge-
liebten sich dem Dichter im Traume 6ffnet, oder der Dichter den
Auferstehungstag lieber neben Feinsliebchen in der Gruft vet
trédelt, als sich Richtung Josephat zu begeben — so ist stets
ner, cher galante Tod gemeint: ,,der Tod im figiirlichen Sinne“,
mit dem Heine hier sein mutwilliges Spiel treibt."° Auf Ketten
sin ihrer eisernsten Bedeutung" wird der spite Heine noch zu
Heine Sakularausgabe (HSA) XX, Berlin/Weimar 1970ff., 206.
Vel. DHA U/I 19ff. und 163ff.
133
sprechen kommen,” aber im Gedicht des jungen Heine kommt
der Tod in seiner ,.eisernsten Bedeutung™, als nackte Begeben-
heit der Physis und der Kreatur, noch vergleichsweise selten vor.
‘Anders sieht es aber in der Prosa, sieht es in den Reisebildern
aus. Hier findet bereits eine Auseinandersetzung statt mit Sinn
und Sinnlosigkeit des Todes, deren Tiefe, Intensitiit, Zweifel und
Unruhe verbliiffen miissen, bedenkt man die heitere, siegessi-
chere, lebensfrohe und kampfentschlossene Persona, die diese
politisch-publizistischen Texte dem deutschen Publikum damals
zumindest vordergriindig prisentierte. Aber wenn, nach Adorno,
«das Motiv .... der Abschaffung des Todes die innerste Zelle
jeglichen antimythologischen Gedenkens ausmacht™,” so. ist
damit auch der Grund sowohl fur Heines Auseinandersetzung
wie auch fiir die tiefe Beunruhigung durch diese Auseinander-
setzung benannt: Der Tod ist fiir Heine der drohende Triumph
der Naturgeschichte uber die menschliche Geschichte, des my-
thischen Kreislaufs des Immerwiedergleichen tiber den Versuch
progressiven Fortschreitens, des neuen, nie dagewesenen histori-
schen Entwurfs. Und als solcher ist er Heine schlicht verhaBt,
und zwar so sehr, da er nicht einmal gewillt ist, die ibliche
Assimilation des Todes an die Historie, als notwendiges, sinn-
volles Opfer fiir die kiinftigen Generationen, so ohne weiteres
gelten zu lassen. Dafir ist er zu sehr Individualist, und dafuir
scheint ihm die Wiedereinfuhrung des ,Opfers" den ersehnten
ProgreB der Geschichte, in Richtung eines erfiillten Lebens aller,
gar zu sehr Liigen zu strafen. ,,Still davon", lat er da die stum-
men Toten sagen.” Und noch in dem Augenblick, wo Heine sich
das Freiheitsfest ausmalt, wo alle, ohne Riicksicht auf Stand und
Herkunft, ,,Versdhnt und allgleich", um denselben Tisch sitzen,
gibt sich der Autor keiner friedlichen Stimmung hin, sondern
ihm kommt vielmehr der Gedanke, ..vereinigt gegen andere
Weltibel* zu kampfen, ,.vielleicht am Ende gar gegen den
Tod“.”’ Denn der Tod bleibt fir Heine der lauernde Erzfeind, der
Inbegriff mythischer Vergeblichkeit, wie in dem folgenden iiber-
‘Adomo/Max Horkheimer, Dialektik der Aufkléirung (Adorno Gesam-
‘melte Schriften 3), Frankfurt a, M. 1981, S. 95f,
“DHA VIV/I. 71.
” DHA VII, 70,
134
raschenden mythologischen Gleichnis fir die eigene publizi-
ch-politische Arbeit, das Heine seinem erzihlenden alter ego
in den Mund legt, dann aber gar nicht zu Ende fiihren
Ich trieb mein gewéhnliches Geschift... ich rollte wieder den gro-
Gen Stein. Wenn ich ihn bis zur Halfte des Berges gebracht, dann
rollte er plotzlich hinunter, und ich muBte wieder suchen ihn hin-
aufzurollen, — und dieses Bergauf- und Bergabrollen wird sich so
lange wiederholen, bis ich selbst unter dem grofen Steine liegen-
bleibe, und Meister Steinmetz mit groBen Buchstaben darauf
schreibt: Hier ruht in Gott —
Der Tod als Steigerung und Besiegelung des mythischen Ver-
hiingnisses: Sisyphos, der von seinem eigenen Stein plattgewalzt
wird, so daB er dem Heros dann auch noch zum Grabstein wird.
Auch an anderer Stelle wei8 der junge Heine, die Bilder mythi-
scher Vergeblichkeit nicht nur aufzugreifen, sondern gar zu po-
tenzieren. So in dem folgenden Bild von der ewigen Regenerati-
onskraft der Erde, wo diese aber von der unaufhérlichen Rege-
nerationsarbeit so erschépft ist, daB sie ganz und gar unfuhig
wird, das Neue hervorzubringe!
Aber noch schlimmer als dieses Gefithl eines ewigen Sterbens,
einer éden giihnenden Vernichtung, ergreift uns der Gedanke, da
wir nicht einmal als Originale dahinsterben, sondern als Copien
von lingst verschollenen Menschen, die geistig und kérperlich
uns gleich waren, und daB nach uns wieder Menschen geboren
werden, die wieder ganz aussehen und fidhlen und denken werden
wie wir, und die der Tod ebenfalls wieder vernichten wird — ein
trostlos ewiges Wiederholungsspiel, wobey die zeugende Erde
bestiindig hervorbringen und mehr hervorbringen muB, als der
Tod zu zerstéren vermag, so daB sie, in solcher Noth, mehr fiir
die Erhaltung der Gattungen als fiir die Originalitiit der Individu-
en sorgen kann.
"DHA VIV/I, 87,
DHA VIN/I, 79,
135
Die pessimistischen Anwandlungen, die sich Heines Erzihl-
Ich bemiichtigen, miinden dann an einer Stelle in dem verzwei-
felten Ausruf:
das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein Lazareth!*
»Und der Tod ist unser Arzt-* Ach! Ich will nichts béses von ihm
reden und nicht Andre in ihrem Vertrauen stéren; denn da er der
einzige Arzt ist, so mégen sie immerhin glauben, er sey auch der
beste, und das einzige Mittel, das er anwendet, seine ewige Erd-
kur, sey auch das beste."*
Noch sann Heine indes auf eine andere Kur, auf andere Mitel,
die kranke Erde zu heilen; und alle Machte und Gewalten, die
dagegen standen, blieben in seiner Vorstellung stets mit dem
Tode verschwistert.
Wenn aber der Tod mitten in Heines gesellschaftspolitischem
Diskurs auftritt, so ist das Bild des Todes selber bei Baudelaire
ein politisches. Nun sagt man von der Politik, daB sie seltsame
Bettgenossen macht, und das seltsame poetisch-politische Biind-
nis, das Baudelaire nach 1848 eingehen wird, bestitigt auf seine
Weise das alte Sprichwort von der Unberechenbarkeit und
Wechselhaftigkeit politischer Frontenbildungen. Denn Baude-
laire wird das politische Bundnis nicht etwa gegen, sondern mit
dem Tod eingehen. Und die Erklirung hierfur konnten wir auch
jedem Handbuch zur Politik entnehmen. Namlich wenn die eine
Macht zu einer Vormachtstellung gelangt, gar hegemonial wird,
begibt man sich auf die Suche nach neuen, auch unverhofften
Biindnispartnern. Baudelaires poetischer wie politischer Ge-
brauch des Todes entstammt wohl einer solchen Suche. Nach
1848 ist die bedriickende Hegemonialstellung der birgerlichen
franzésischen Gesellschaft des Second Empire fiir ihn sowohl
schier unerschiitterlich wie schier unertriglich geworden. Wie
Faust der Pakt mit dem Teufel, bietet sich da fir Baudelaire der
Pakt mit dem Tode an. Weit davon entfernt, wie Heine noch
besorgt zu sein um den Bestand des geschichtlichen und gesell-
schaftlichen Entwurfs gegeniiber Mythos und Natur und sich
DHA VIM/, 171
136
also vor der Rache der ersten an der zweiten Natur zu furchten,
kann Baudelaire dieser Rache durchaus Geschmack abgewinnen,
und den Tod als Trumpfkarte gegen die Ubermacht der Gesell-
schaft ausspielen. Schén wire es wohl, dem ‘falschen’ Leben
der Gesellschaft das Bild ‘richtigen’ Lebens entgegenhalten zu
kénnen. Was Baudelaire, von solcher geschichtlichen Méglich-
keit ohnehin schon abgeschnitten, dem ‘falschen’ Leben des
Second Empire stat dessen entgegenhilt, ist das Bild des Todes.
..Weder Pest noch Cholera” — auch ein zu beherzigendes poli-
tisches Sprichwort — hatte da ein Heine dem Dichterkollegen
vielleicht noch warnend aus dem Schattenreich zurufen mégen.
Indes — ob Heines Beschreibung der Cholera in Paris das Zu-
standekommen jener seltsamen Baudelaireschen Allianz noch
positiv beeinfluBt hat? Da stehen sich, in Heines Franzdsischen
Zustiinden, die beiden Ungetiime, das Pariser Leben und der
Massentod, gegeniiber, bevor es dem Wiiten der Epidemie ge-
lingt, kurz die Oberhand zu gewinnen und das Ungeheuerlichste
zu bewirken, nimlich die Stadt der brausenden Bewegung zum
Stillstand zu bringen.™ Paris im Stillstand — ist das nicht der
Traum des Charles Baudelaire gewesen? War dieser Stillstand
nicht vielleicht sein elementarstes Bediirfnis, wie das elementar-
ste Bediirfnis seines beriihmten deutschen Dichterkollegen gera-
de die Bewegung war? Auffallend allerdings ist die sehr unter-
schiedliche Haltung beider Dichter zu der Ewigkeit. Die Ewig-
keit konnte Heine im Prinzip nur ein miides Gahnen entlocken.
Baudelaire aber, dessen Name stirker noch als Heines mit der
Einfuhrung einer Asthetik des Flichtigen in die europiische
Lyrik verbunden ist, sieht in seinem Programm der modernen
Kunst, auf zuniichst fast altvaterlich anmutende Weise, darin
ausdriicklich noch einen Platz flr die Ewigkeit vor.” Das ist
jedoch kein Relikt, sondern tatsiichlich kontemporires Bediirf-
nis. Baudelaire braucht die Ewigkeit, um sich die Zeit vom Lei-
be zu halten, wie er den Stillstand braucht, um sich vom — my-
thischen? — Fluche der Bewegung zu befreien, wie er den Tod
braucht, um ein anderes als nur die Vorstellung dieses Lebens zu
haben. Vielleicht konnte nur die Stadt, die von sich am ehesten
“DHA XIV/I, 1336
La modemité, c'est le transitoire, le fi
Fautre moitié est ’étemel et immuable.
sf, le contingent, la moitié de Mart, dont
fuvres, 1163.
137
behaupten konnte, alles zu sein, in einem kritischen Zeitgenos-
sen so das Bediirfnis nach dem Nichts aufkommen lassen. Bau-
delaire teilt uns Ubrigens in Les Fleurs du Mal selbst mit, wie er
dazu kam, Geschmack daran zu finden:
LE GOUT DU NEANT
Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,
L’Espoir, dont I’éperon attisait ton ardeur,
Ne veut plus t’enfourcher! Couche-toi sans pudeur,
Vieux cheval dont le pied chaque obstacle bute.
Résigne-toi, mon coeur; dors ton sommeil de brute.
Esprit vaincu, fourbu! Pour toi, vieux maraudeur,
L'amour n’a plus de godt, non plus que la dispute;
Adieu done, chants du cuivre et soupirs de la flate!
Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur!
Le Printemps adorable a perdu son odeur!
Et le Temps m’engloutit minute par minute,
Comme la neige immense un corps pris de roideur;
Je contemple d’en haut le globe en sa rondeur
Et je n'y cherche plus I’abri d’une cahute.
Avalanche, veux-tu m’emporter dans ta chute?
Wenn da die Lawine ihn in den Abgrund zu reiBen geruhte —
Baudelaire stand an der Haltestelle bereit.
IV
Den méglichen Fluchtweg der Reise — das heiBt, eine andere
Reise als die in den Tod anzutreten, um der Gegenwart zu ent-
kommen ~ hatte Baudelaire fiir sich nimlich bereits abgeschnit-
ten. Weder er noch Heine kénnen dem Motiv der befreienden
exotischen Reise, wie sie in der romantischen Literatur verbrei-
tet und dann unter den franzésischen Literaten des 19. Jahrhun-
derts virulent wird — man denke an Chateaubriand, Nerval, Flau-
Euvre
138
bert, auch Rimbaud hat ja dann Richtung Afrika ReiBaus ge-
nommen — etwas abgewinnen. Und zum Rang beider gehért
wohl diese prinzipielle Verweigerung, durch Schweifen in eine
vermeintlich unbeschwerte Ferne die Konfrontation mit der ei-
genen Gesellschaft, an der sie litten, zu scheuen, So gibt Heine
dem exotierenden Bedirfnis der Romantik zwar in dem einen
frilhen Gedicht Auf Fliigeln des Gesanges glltige Gestalt, das
Motiv der exotischen Reise verstummt dann bei ihm bis in die
Spitzeit. War er doch Uber Jahrzehnte in der europiiischen Ge-
genwart unterwegs: als Autor der Reisebilder und ,.verizifizier-
ten Reisebilder™ in Deutschland, Italien und England, als deut-
scher Kundschafter vom Pariser Leben und franzésischen Zu-
stiinden. Die ,,Europamiidigkeit* holt ihn erst nach 1848 ein, und
da mehren sich zwar schlagartig die exotischen Stoffe. Aber
auch dann erwarten den Leser, falls er nur um der schénen Ferne
willen zu diesen Texten griff, einige bose Uberraschungen. Das
Sklavenschiff beispielsweise, mit seinem bunten brasilianisch-
afrikanischen Kolorit, filhrt dem Leser den ganzen Sklavenhan-
del sowie das, was Marx ein Jahrzehnt spiter ,die urspriingliche
Akkumulation des Kapitals” nennen sollte, mit erschreckender
Anschaulichkeit vor, und mit unmiBverstindlichen Anklingen
nicht nur an fremde afrikanische, sondern an cinheimische pro-
letarische Unterwelten. In Vitzlipurzli, einer Elegie auf das
altmexikanische Reich, wird Kolumbus mit recht zweideutigem
Lob bedacht:”
Nicht befreyen konnt’ er uns
Aus dem dden Erdenkerker,
Doch er wuBt’ ihn zu erweitern
Und die Kette zu verlingern.
Die Reise als verlingerte Kette vermochte Baudelaire dann
genausowenig zu interessieren — bei allem Interesse an exoti-
schen Stoffen und Menschen. Freilich, im Baudelaireschen
Kosmos mag es sogar so etwas wie die schéne Ferne durchaus
gegeben haben. Wie im Kafkaschen die Hoffnung. ,.Nur nicht
fiir uns“, wie Kafka Max Brod dann erginzend mitteilte; das
hei&t dann bei Baudelaire Bien loin d'ici, was so viel bedeutet
DHA IIM/., 60.
139
wie: uns unerreichbar.” Denn wir miiBten ja uns selber ablegen,
um an jene schéne Ferne zu gelangen. In Le Voyage a Cythere
fuhrt Baudelaire sich und seinen Lesern diese bittere Lektion
unmiBverstindlich vor: Was niitzt mir die weiteste Reise, wenn
ich dabei nicht aus meiner Haut heraustreten kann? So wird erst
die Reise interessant, bei der man aus seiner Haut heraustritt,
Oder wie Baudelaire seine Seele antworten laBt, als er die Frage
des déménagement, des Umzugs, mit ihr anspricht, die er, so
seine Mitteilung, unablassig mit ihr zu diskutieren pflegt. Wo
michte sie dann hin? Nach Lissabon, nach Rotterdam, nach den
Tropen, nach dem Pol? Die Antwort: Anywhere — ,,Anywhere
out of the world!”
Vv
Bevor wir Heine und Baudelaire jedoch auf jene letzte Reise
hinausbegleiten, ist es vielleicht aufschluBreich, einen Aspekt
kurz zu bedenken, der in der Folge wichtig sein kénnte. Auch in
einer Krise, wo es um die letzten Dinge geht, wird jeder intuitiv
auf die Verhaltensweisen zuriickgreifen, die ihm durch bisherige
Lebenskrisen geholfen haben. Auf das Problem der kiinstleri-
schen Form iibertragen heiBt dies, daB in Krisen die Dichter sich
ihrer ureigensten stilistischen Mittel und Motive sowohl wieder
einmal vergewissern, als auch diese oft bis an eine duBerste
Grenze treiben. Gedichte sind Krisen; und die Gedichte Le
Voyage und Bimini sind krisenhaft in hohem MaBe: das bedeutet
sowohl Kulminationspunkte von langjihrigen Entwicklungen
wie auch einschneidende, definitive Katastrophen. Die kontra-
stierenden Impulse, die kontrastierenden Lésungen, die kontra-
stierenden Hilfs- und Rettungsmittel heiBen hier abermals Still-
stand und Bewegung. Es gibt zwei Gedichte von Heine und
Baudelaire, die wie Bimini und Le Voyage thematisch verschwi-
stert sind und wo dieser Kontrast besonders grell zutage tritt. In
beiden kommt ebenfalls ein Gegensatz zu Wort, der in der da-
* Guvres, (71f. Was diese Feme sein konnte, hatte Baudelaire in L‘invitation au
Voyage bereits ausgemalt, ohne jedoch anzugeben, wie man dorthin gelangen kénne.
~ wrres, 3036.
140
maligen Zeit fast so uniiberwindlich und unentrinnbar erschie-
nen sein mag wie der von Tod und Leben und mitunter so er-
schreckend gewirkt haben wird wie der Sensenmann in Person:
Es ist der Gegensatz von arm und reich. Und beide Gedichte,
Heines Wanderratien und Baudelaires Abel et Cain, sind bis in
ihre innerste Formgebung von diesem Prinzip der Gegensitz~
lichkeit geprigt. Jedoch bei Heine ist dieser Gegensatz sofort
Ausléser einer iberbordenden Dynamik: Halb als biirgerliche
Angstvision, halb als karnevalistische Phantasie stiirmen dort,
vom Hunger getrieben, die plebejischen Wanderratten die ge-
sellschaftlichen Héhen. Schon mit den ersten beiden Versen
geraten wir in einen Sog, der erst dann nachlaBt, wenn er uns an
jene Anhéhen aufgespiilt hat. Bei Abel et Cain dagegen herrscht
eine geradezu unbewegliche Starre, die eher an die Physik des
Monées als an die der Erde mahnt. Vierzeiler folgt Vierzeiler, in
jedem werden Abel und Cain, Oben und Unten, kontrastierend
dargestellt, ohne daB die beiden indes, trotz der Suggestion des
Titels, jemals in Berihrung kiimen. Wo bei Heine ein Gesetz des
Sogs, der mitreiBenden, unwiderstehlichen Dynamik, gar der
Beschleunigung vorherrscht, gleicht der Blick Baudelaires hier
eher dem Facettenauge eines Insekts, das Prozesse unendlich zu
verlangsamen vermag, bis hin, in diesem Fall, zum virtuellen
Stillstand, zu jener Paralysis, von der Benjamin bei diesem
Dichter gesprochen hat.” Aber diese Paralysis ist zugleich auch
Dynamis. Denn es ist, als ob Baudelaire aus dem Stillstand einen
gleichsam geologischen Druck erzeugen méchte, der zu jenem
befreienden Schlag fihren kénnte, den uns der Titel verheiBt.
Und wie in der klassengesellschaftlichen Urszene von ‘arm’ und
‘reich’, so verfolgen auch in der existentiellen Urszene von Tod
und Leben Heine und Baudelaire ebenso verwandte wie entge-
gengesetzte Strategien: Heine wird durch Bewegung noch die
starre Front des Todes aufzubrechen suchen: Baudelaire dagegen
hofft, gerade aus dem Stillstand des Todes die unerhérte Bewe-
gung zu generieren.
Denn von woanders wird sie nicht herriihren. ,,Der Lichtstreif
unter der Schlafzimmertiir ... war er nicht das erste Reise-
So beobachtet Benjamin bei Baudelaire ein ..Erstarrungsvermogen ... das .. als eine
Art Mimesis des Todes sich hundertfach in Baudelaires Dichtung kundtut.” Walter
Benjamin, Gesammelte Schriften (GS), Frankfurt a. M. 19724f., Bd. Il, S. 587.
141
signal?“, heiBt es in Benjamins Berliner Kindheit.” Und mit der
unbiindigen kindlichen Erwartungshaltung, vor den ausgeb
teten Karten auf dem Tisch im abendlichen Lampenlicht, setzt
Baudelaires Gedicht ein.” Diese Erwartung wird indes alsbald
enttiuscht. ,,Ah, que le monde est grand a la clarté des lampes!/
Aux yeux du souvenir que le monde est petit!** Es ist also kei-
neswegs darauf zuriickzufuhren, daB Baudelaire den Reiz der
Reise nicht verstanden hat, daB er sie verwirft. Sondern diese
Kritik entspringt der Identifikation. Wer die Ilusion, die Ver-
lockung der Reise, bis auf ihren Grund gekannt hat, gerade der
ist der Berufene, die Reise ihres Ilusionscharakters gnadenlos
zu Uiberfithren. ,,Le mirage rend le gouffre plus amer."* Mirage“
und ,gouffre“: VerheiBung der Ferne, Abgrund der Erniichte-
rung, mit einer kulminativen Regung beschwort sie Baudelaire
wie ein alter Zauberer ein letztes Mal herauf. Aus dem Munde
der ,étonnants voyageurs* selbst vernehmen wir den Bericht
sowohl iiber die gesehenen fremden Herrlichkeiten wie das Ge-
stindnis ihres letztlich blo8 illusorischen Charakters. Denn et-
was Anderes als das, wovor sie daheim die Flucht ergriffen,
haben die Reisenden in der Ferne auch nicht entdecken kénnen.
Und folglich zerschellt die Aufzihlung fremder Herrlichkeiten —
wie vielleicht nur Baudelaire sie in solcher trunkenen Sinnes-
pracht vorfihren kénnte — an der schlichten, lapidaren Frage:
Et puis, et puis encore?
Und um die niederschmetternde Antwort auf den Begriff zu
bringen, kann man vielleicht nichts Besseres tun, als da aus
nem exotisierenden Heine-Gedicht, dem Vitzlipurzli, zu ziteren:
»'Menschenopfer’ heiBt das Stick", das hier wie dort aufgefiihrt
wird.” Sei’s — eine charakteristische Baudelairesche Note — in
den degradierenden Martern des Liebesspiels, sei’s in den Herr
und Knecht gleichermaBen brutalisierenden Praktiken der
Machtausibung, sei’s in der Art wie Religion und Kultur sich
hergeben, um dieses Brutale zu verkliren, sei’s in der Ver-
zweiflung schlieBlich, mit der die weniger Dummen in Shanghai
wie in Paris da zu ihrem Opium greifen. Aus fern und nah das
gleiche ,,éternel bulletin", die gleiche ewige Nachricht. Sie 1iBt
"Benjamin GS IV, S. 245.
uvres, 122,
DHA LIVI, 68
142
die Welt fatal zusammenschrumpfen, die sich so verheiBungs-
voll vor den kindlichen Augen ausgebreitet hatte.
Wenn aber die Fata Morgana der Ferne nur den Abgrund der
Emniichterung verbirgt — birgt der letzte Abgrund viclleicht das
Gliick? Das ist der paradoxale Umschlag, mit dem Baudelaires
»Reise“-Gedicht iiber die Unméglichkeit der Reise dann kulmi-
niert. In einer letzten Wendung appelliert Baudelaire an jenen
Kapitan — den Tod -, der vielleicht am ehesten den Aufbruch zu
neuen Ufern und zu unbekannten Himmeln schafft. Was Heine
die alte Erdkur war, ist Baudelaire /e dernier cri, und was Ben-
jamin den Baudelaireschen Heroismus nannte, namlich den Ver-
such, aus dem Immerwiedergleichen das Neue herauszuschla-
gen,” zeigt sich auch hier, wo Baudelaire der alten Erdkur, dem
Immerwiedergleichen, der ,,gihnenden Vernichtung" des Todes,
einen aparten haut godt abzugewinnen trachtet. So miindet sein
Appell an den Capitaine la Mort in dem unvergessenen Ausruf:
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe?
Au fond de I’Inconnu pour trouver du nouveau.
wlhr werdet eines Morgens die Bude geschlossen finden, wo
Euch die Puppenspiele meines Humors so oft ergétzten", sagt
der sterbende Heine im Nachtwort zum Romanzero.” Aber viel-
leicht war das VerheiBungsvolle und Verlockende des Todes fiir
Baudelaire eben dieses, dab er die Bude schlieBt: die Bude jenes
Welttheaters niimlich, wo immer nur das gleiche Puppenspiel
gegeben wird.
Dennoch zeigt sich gerade in dieser Absage an die eigene Ge-
sellschaft die tiefste Verbundenheit mit ihr. Zur Erhellung sol-
cher Verbundenheit mag die folgende Geschichte dienen. Ein
deutscher Jude, ein ,,Jecke wie die deutschen Juden auf jiidisch
hieBen, kam als junger Mann nach Palistina. Er beteiligte sich
an den Aktionen gegen die britische Kolonialmacht, Bei einer
konspirativen Sitzung stellte es sich aber heraus, daB das Haus
umzingelt war. Das Ultimatum: Die Verschwérer hitten fiinf
Minuten, sich zu ergeben, danach eréffne man das Feuer. In
dieser Lage fand der Jecke eine wichtige Beschiftigung: Er
Benjamin, GS I, 673.
DHA III, 178,
143
riickte seine Krawatte sorgfiiltig zurecht. Daraufhin von einem
seiner Mitverschwérer etwas unwirsch angesprochen, gab er
zuriick: Als Jecke bin ich geboren, als Jecke will ich sterben."
Was dem ,,Jecke" aber recht, ist dem Pariser Dandy billig. Auch
er riickt angesichts des Todes seine Krawatte sorgfiiltig zurecht;
auch der Dandy will als Dandy sterben. Und das heift: Er miBt
den Tod an demselben Anspruch, den er an das Leben stellte.
Und das heift in diesem Fall: das Unerhirte, das Prickelnde, das
Aufregende, das Neue zu produzieren. Was er aber der Moderne
damit héhnisch abspricht, ist nichts anderes als der Anspruch der
Moderne selbst. Das ist Baudelaires ,Heroismus der Moderne",
und er verwirft eher das Leben selbst, als diesen Anspruch auf
das Neue preiszugeben.
Uber die Cholera in Paris hatte Heine geschrieben: daB die
Metropole skeptisch gegeniiber groBen auswirtigen Reputatio-
nen sei — und folglich auch gegeniiber der Epidemie. Bei ande-
ren Gelegenheiten hat der Pariser Dandy Baudelaire sogar ge-
geniiber einer noch griBeren Reputation eine gehérige Dosis
mondiiner Skepsis an den Tag gelegt: In dem Réve d’un curieux
fragt er sich, ob, wenn da der Vorhang zum Jenseits endlich
aufgeht, die Vorstellung ihn nicht doch enttduschen werde. Man
kann nur hoffen, da8 als der Tod dann am 31. August 1867 zu
Baudelaire gekommen ist, die Vorstellung den Dichter nicht
enttduschte.
VI
‘Von dem Tode hatte sich Heinrich Heine dagegen nie etwas
versprochen; wohl aber von der Geschichte. Und damit ist ein
wichtiger Unterschied zu Baudelaire, und zu Baudelaires Ge-
dicht, genannt. Heines Bimini handelt zwar auch von einer Le-
bensreise in den Tod." Jedoch ist diese Reise zugleich eine Rei-
Zu Bimini vgl. wa. Ernst Bloch, ,.Ponce de Léon, Bimini und der Quell™, Verfrem
dungen, Frankfurt a. M. 1968, S. 226ff.; Jurgen Jaco r spite Heine und die
Utopie - zu "Bimini", Etudes Germaniques 22 (1967), S. S11ff.; Michel Espagne.
Die fabethafte Irfahrt. Heines spite Entwicklung im Spiegelbild der Hand-
schriften™, Heine-Jahrbuch (23) 1984, S. 691f; Stefan Bodo Wurlfel, Der produktive
Widerspruch: Heinrich Heines negative Diaiektik, Bern 1986, S. 292 ff.; Markus
144
se in die Geschichte. Vordergriindig spricht Heine ja uberhaupt
nicht von sich, sondern von dem conquistador und hidalgo Pon-
ce de Leon und dessen Suche nach der Insel der Ewigen Jugend:
alles historisch belegte Begebenheiten, die Heine Washington
Irvings Reisechroniken entnommen hat. Jedoch mit jener para-
bolischen Meisterschaft, die ihm eigen ist, vermag Heine die
eigene Lebensgeschichte der Geschichte Ponces aufzudriicken
und einzuschreiben, ohne der Fabel aus der Historie Gewalt
anzutun. Das heift aber nichts anderes, als daB sich dieses Ge-
dicht der Geschichte sowohl radikal verschreibt als auch ver-
weigert. Das Gedicht ist Geschichte und zugleich das, was ,.ne-
ben" der Geschichte hergeht, ohne in der Geschichte aufzuge-
hen.”
Was indes an Heinescher Geschichte in die Geschichte Ponces
hier eingegangen ist, 1aBt sich an drei Motiven kurz aufzeigen.
Zuntichst an dem Motiv des Schiffes. Denn lange bevor er mit
Ponces Schiff hinaussegelt, ist Heine das Schiff Metapher seiner
politischen Arbeit: In seinem Lutezia-Vorwort spricht er von der
guten Ladung, die er als ,,durchaus politischer Schriftsteller™ an
Bord seines publizistischen ,,Freibeuter"-Schiffes hatte. Im Bor-
ne-Buch sieht er das Schiff seines politischen Mitstreiters und
Widersachers Bérne untergehen, wiihrend er hilflos zusehen
muB, da er die ihm anvertrauten Schiitze an Bord des eigenen
Schiffes — die ,,Gétter der Zukunft" — nicht dem sicheren Ver-
derben preisgeben darf. 1843, als er die Zusammenarbeit mit
Marx und dem Pariser Vorwairts anvisiert, besteigt er, wie er im
Gedicht Lebensfahrt sagt, ,,ein neues Schiff* mit neuen Gefuhr-
Winkler, Mythisches Denken zwischen Romantik und Realismus. Zur Erfahrung kul-
tureller Fremdheit im Werk Heinrich Heines, Tubingen 1995, S. 224-23)
Ein Moment dieser aller Geschichtserfahrung innewobnenden Spannung ist fur Heine
zweifellos das von Schrecken und VerheiBung. Der Geschichte ist beides
cingeschrieben: die Verhei®ung, die noch nicht eingeldst wurde, der Schrecken, der
dafur in der Geschichte umso zweifelsfreier prasent ist. In dem Bimini-Gedicht fallt
beides in der Person des Ponce zusammen: Der Zwiespalt, der in Virsliputcli in den
kontriiren Rollen des visioniren Entdeckers Kolumbus und des ..Rauberhauptmanns",
des blutigen Eroberers Cortez, noch in der Entzweiung existerte, wird von Ponce nun
in einer Person verkorpert. Zur Identifikation Heines mit Ponce gehirt indes, da
Heine auch den eigenen politischen und revolutioniiren ..Kampf* durchaus als
Kampf, als ,.Befreiungskrieg™, gar als .Schlachtfeld™ begriffen hat und sich selber als
Kampfer; sowie auch, daB fir Ponce die Suche nach Bimini den Ausbruch aus der
Geschichte als Schrecken und hin zur Geschichte als VerheiBung beinh:
145
ten und Gefahren.” SchlieBlich schickt er dem Schiff Ponces, in
der eigentiimlichen Verdoppelungs- und Spiegelungsstruktur des
Bimini-Gedichts, das eigene ,,Zauberschiff* und ,,Narrenschiff*
voraus, ein seltsames Konstrukt, das Heine in der eindeutigen
Identifizierung als das Schiff der eigenen Lebensreise nicht nur
aus den poetischen Mitteln Trochiien, Metaphern, Witz und
Phantasie zusammenzimmert, sondern mit einer eigenen Fahne
ausstattet, der schwarz-rot-goldenen ,,Trikolore Barbarossas“,
der Fahne von Politik und Romantik, von Kyffhiuser-Berg und
Paulus-Kirche, der seltsam hybriden und unméglichen Standarte
einer deutschen Revolution — und Emblem damit auch des Hei-
neschen Lebenswegs.” Unter dem Zeichen dieser poetischen
Identifikation 1a8t Heine dann Ponce seine Reise antreten.
Das Narrentum Ponces ist ein weiteres urheinesches Motiv,
das in diesem summierenden Gedicht zu Ende gefihrt wird.
Denn nicht nur, daB dieser Ponce eher hidalgo ist als conquista-
dor und daB seine Suche an die Irrfahrten und Abenteuer jenes
anderen groBen hidalgos, an Don Quixote, mahnt — zeitlebens
auch eine groBe Heinesche Identifikationsfigur. Dem Dichter
selber platzen ja die Nihte seiner Narrenjacke, wie er von dem
tollkiihnen Projekt des Ponce hért. Aber wer sind sie, Heines
Narren? Im Winterméirchen, i in seiner Anrede an den Vetter Jesu,
spricht Heine es unmittelbar aus: ,,Du Narr! Du Menschheits-
etter!" Die Narren sind bei Heine die, die gegen die bestehen-
den Strukturen der Welt anrennen, um die revolutionare Wen-
dung zum Guten herbeizufiihren — wie ja auch Ponce bei Heine
auch ,,Menschheitsretter* und ,,Weltwohltither™ heiBt.”
Das dritte groBe Heinesche Motiv ist das Motiv der Krankheit.
War Heine doch schon immer ein groSer Kranker, und dies lan-
ge bevor ihn die Riickenmarkdarre heimsuchte und ihn an die
“- Vgl. DHA XIIV/1, 293; DHA XI, 338; DHA I, 117.
* Andem Schnittpunkt nach dem ersten autobiographischen Teil des Gedichts. wo die
Ponce-Handlung eingefuhrt wird, stehen Zeilen, die diesen eigentimlichen Spiege-
lungseffekt deutlich heraufbeschworen: ..Binsam auf dem Strand von Cuba/ Vor dem
Stillen Wasserspiegel/ Steht ein Mensch und er betrachteU/ In der Fluth sein Conter-
fey." DHA IV, 368,
© In Die Stadt Lukka nennt Heine ,,die Donquixoterie ... das Preiswertheste des Lebens,
ja das Leben selbst"; im Nachwort zu den Reisebildemn IV stellt er sich selber als der
Narr des deutschen Volkes dar, welcher diesem im Kerker Darniederliegenden eine
slorreiche und erfillte Zukunft prophezeit. DHA VIV/L. 198 u. 2721. Zu Christus als
Narr vgl. DHA IV, 118: 2u Ponce als ,.Menschheitsretter” DHA IIV/1. 380f.
146
Matrazengruft fesselte. Denn krank und leidend war Heine
schon, wie wir alle, an den Gebresten, die er aus der Vergangen-
heit geerbt hatte; sowie an den Gebresten, die ihm wie seinen
Juden (in dem Gedicht Das Neue Israelitische Hospital zu Ham-
burg) der politische und soziale Zustand der Gegenwart be-
scherten. Heine diagnostizierte also die Krankheit der Zeit: aber
— und das macht auch seine GréBe als Zeitdiagnostiker aus —
anders als die meisten bezog er sich selber stets als Kranker in
die Diagnose gleich mit ein: Er, der wuBte, ,,was Gesundheit
ist“, hat dennoch nie von sich behauptet, damit selber gleich ein
Gesunder zu sein. Und in der Tat: Der Heinesche Begriff der
Krankheit ist so elementar und umfassend, daB man schon sehr
weit in die Geschichte sprachlicher AuGerung zuriickgreifen
mu8, um etwas von ihnlicher, entsprechender Radikalitét zu
finden; und zwar findet man es vielleicht in den Sprachen ge-
wisser Naturvélker. Diese teilen die Welt bekanntlich nicht etwa
grammatikalisch in Maskulin, Feminin und Neutrum ein, son-
dern in ,,tot oder ,,lebendig™, ,,belebt™ oder ,,unbelebt*. Aber
mehr: Sobald etwas krank, leidend, zerbrochen, defekt, gestdrt,
nicht im Einklang mit sich selbst ist, vertauscht man die Artikel;
somit wird das Lebendige ,,tot" und das Tote ,,lebendig. Und
somit setzt man gleichzeitig mit den Dingen auch die Bezeich-
nung entweder ihres gleichsam ontologisch stimmigen oder aber
ihres defizitiren Zustands. Nun: Mit dem Bild der Krankheit
setzt Heine vor sich wie vor die Welt das Zeichen des defizitéren
Zustands; er selber ist der groBe Dichter der defizitéren Zustan-
de. Und nach 1848, nach der eigenen Erkrankung und der er-
neuten Erkrankung der Welt nach den niedergeschlagenen Re-
volutionen, fallen die Sphiren der Krankheit bei diesem Dichter
endgiltig zusammen. ,,Ganz entsetzlich ungesund/ Ist die Erde,
und zu Grund’,/ Ja, zu Grund’ muB alles gehn,/ Was hienieden
groB und schén.““' Dagegen segeln Heine und Ponce in Bimini
auch an.
Dies umso mehr, als die Suche nach der Heilquelle, nach dem
Jungbrunnen, ebenfalls ein altes Heinesches Motiv war, lange
bevor er bei Washington Irving die Geschichte nachgelesen
hatte oder selber als Todkranker auf dem Siechbett darniederlag.
DHA II/1, 354.
147
Denn bereits 1840 im Bérne-Buch fragt Heine danach, ,,wo die
verborgene Quelle rieselt, woraus die Menschheit trinken muB
um geheilt zu werden, wo das geheime Wasser des Lebens, wo-
von uns die Amme in den alten Kindermahrchen so viel erzihlt
hat, und wonach wir jetzt schmachten als kranke Greise. — Wo
flieBt das Wasser des Lebens? Wir suchen und suchen.. Mit
anderen Worten: Die Heilquelle, der Jungbrunnen, den Ponce im
Wortsinn in der geographisch ,,Neuen Welt Amerikas suchte,
war immer schon das Gleichnis dafiir gewesen, was Heine in der
zeitlich und politisch ,,neuen Welt“ der Modernitit gesucht hat-
te. Somit ist Ponces Suche Heines Suche und Ponces Reise Hei-
nes Rei:
Nun wissen wir alle, wo diese Reise endet: im Tode. Das Was-
ser, von dem Ponce trinkt, ist das Wasser ,,Lethes“, und er stirbt,
wo er sich am Ziele wahnt: Die ewig ,,verjiingende" Macht des
Todes ist die Antwort auf seine Suche gewesen, die dieser Suche
zugleich den abgriindigsten Hohn zu sprechen scheint. Mythos
und Politik, Natur und Geschichte: Hier scheint sich der politi-
sche Auftrag der Moderne, die mythische VerheiBung des Gol-
denen Zeitalters, des Jungbrunnens, in der Geschichte zu ver-
wirklichen — sprich ,,.Bimini* — zuriickgenommen in die alte
Ubermacht, die traditionelle Verschworenheit des Mythos mit
dem Tod und dem natiirlichen Kreislauf, sprich ,,Lethe"; ja, der
Versuch der Verwirklichung scheint gerade diese alte Uber-
macht erneut zu offenbaren. Galt Baudelaire in seinem Spleen
der Tod geradezu als utopisches Moment, so erscheint Heine in
seiner Hoffnung der Tod zunichst in seiner vertrauten Rolle, als
vollendete Anti-Utopie.
Das Seltsame aber ist, da8 in der zutiefst paradoxalen Struktur
des Gedichts dieser fatale und scheinbar endgiiltige Schlu8 zu-
gleich in ein Offenes gewendet wird. Das geht letztlich darauf
zuriick, daB Heine — anders als Baudelaire — seine und Ponces
Suche in der Geschichte angesiedelt hat. Damit wird der Tod
selber Teil der geschichtlichen Bewegung. Denn die Kollision
© DHA XI, 129. Klaus Briegleb hat in seinem Kommentar zu Bimini als erster auf
diese Stelle hingewiesen, ohne allerdings auf den politischen Bezug, den Heine
seinem Gedicht damit als Chiffre einschreibt, aufmerksam zu machen. Heinrich
Heine, Samiliche Schriften, brsg, von Klaus Briegleb, Munchen 1968-1976, Bd. VU2.
8.79.
148
von Ponces Sehnsucht mit dem Tod li8t nicht einfach — Tri-
umph der Naturgeschichte — eine Leiche, sie laBt auch eine Insel
zuriick. Ponce, dem die Erfiillung einerseits verwehrt wird, stirbt
dennoch ,,erfiillt, nicht nur, weil er, entgegen seiner Absicht,
sein naturgeschichtlich vorprogrammiertes Ziel erreicht, nicht
nur, weil seine biologische Lebenszeit abgelaufen und damit
auch ,erfiillt* ist, sondern weil ihm, geschichtlich, als ,,.Entdek-
ker“, die Entdeckung auch vergénnt wird. Und zwar derart, dab
er sie selber nicht tiberlebt. Sein Tod markiert damit freilich
einen krisenhaften Einschnitt, wo Heines ganzes, gebiindeltes
Begehren dann mit einem Mal eine unverhoffte Wendung
nimmt: die ins Tragische. Denn — wie schon der junge Marx
wuBte — ,,der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung iiber
das Individuum™," und Heines Ponce-Gedicht ist zuniichst die
giiltige poetische Ausgestaltung von der ganzen Harte dieses
Sieges:"
Aber ach! jeder Zoll, den die Menschheit weiter riickt, kostet
Stréme Blutes; und ist das nicht etwas zu theuer? Ist das Leben
des Individuums nicht vielleicht eben so viel werth wie das des
ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine
Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem
Grabstein liegt eine Weltgeschichte — ...
In dem heldischen Epos von Ponces Leben und Taten, von
seinem Aufbegehren und Ende, erfahren wir vom Untergang
eines Menschen wie vom Untergang einer ,,Welt*. Auch dieser
Tod verbirgt cine ,,Weltgeschichte*. Tragik aller utopischen
Bestrebungen: Es ist den ,,Entdeckern“ selbst nicht gegeben, von
der Frucht ihrer Entdeckungen zu genieBen. Oder: Diese Frucht
nimmt fiir sie eine radikal andere Form an als die, die sie fiir
sich ertriumt haben. Das aber andererseits markiert gerade ihre
Authentizitat als Entdeckung: Denn sie sprengt alle bisherige
Vorstellung. Die Entdeckung 1a8t den Entdecker nicht unbe-
riihrt. Das heift aber nichts anderes, als daB der Tod hier sym-
bolisch — als einschneidenste aller Verwandlungen — gerade
auch fiir die Authentizitét, das ,,Einschneidende der besagten
“Karl Marx, Die Frihschrifien, Sttgart 1983,
DHA VII/1, 71.
149
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1091)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (842)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (345)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Apollinaire Lettres À Lou'Document570 pagesApollinaire Lettres À Lou'antonio rincon nuñez100% (2)
- Bouveresse 'Karl Kraus'Document111 pagesBouveresse 'Karl Kraus'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Brague 'Entretien'Document22 pagesBrague 'Entretien'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Depusse'Le Jury'Document10 pagesDepusse'Le Jury'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Durand 'Max Jacob Et L'espagne'Document22 pagesDurand 'Max Jacob Et L'espagne'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Reclus Histoire D'un Ruisseau.... 'Document45 pagesReclus Histoire D'un Ruisseau.... 'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Djian '2030'Document141 pagesDjian '2030'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Benny Levy Et BadiouDocument33 pagesBenny Levy Et Badiouantonio rincon nuñezNo ratings yet
- Rebatet 'Les Deux Étendards' 2Document1,201 pagesRebatet 'Les Deux Étendards' 2antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Carabias 'Valle Inclan'Document31 pagesCarabias 'Valle Inclan'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Theologia Car TesianaDocument154 pagesTheologia Car Tesianaantonio rincon nuñezNo ratings yet
- Peters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'Document31 pagesPeters Heines 'Bimini, Baudelaire 'Voyage'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Chaliand 'Entretien 2022'Document9 pagesChaliand 'Entretien 2022'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Guerre Totale'Document19 pagesGuerre Totale'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Michaud Et..'entretien Art, Etat Et Idéologie Aux Xix Et XX Siècle'Document16 pagesMichaud Et..'entretien Art, Etat Et Idéologie Aux Xix Et XX Siècle'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Challemel-Lacour Ëtudes Et Réflexions D'un Pessimiste Et Un Bodhiste en Allemagne SchpenhauerDocument331 pagesChallemel-Lacour Ëtudes Et Réflexions D'un Pessimiste Et Un Bodhiste en Allemagne Schpenhauerantonio rincon nuñezNo ratings yet
- Chestov (Fondane Un Philosophe Tragique Chestov')Document16 pagesChestov (Fondane Un Philosophe Tragique Chestov')antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Brautigan La Pesca de La Trucha en AmericaDocument96 pagesBrautigan La Pesca de La Trucha en Americaantonio rincon nuñezNo ratings yet
- Kiefer El Ser Humano Es MaloDocument6 pagesKiefer El Ser Humano Es Maloantonio rincon nuñezNo ratings yet
- Valery (Bastet 'Mon Faust de Valery')Document18 pagesValery (Bastet 'Mon Faust de Valery')antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Valery (Bastet 'Valer L'enfant Qui Nous Demeure')Document12 pagesValery (Bastet 'Valer L'enfant Qui Nous Demeure')antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Benjamin Teatro Infantil Proletario'Document10 pagesBenjamin Teatro Infantil Proletario'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- China L'art Du Cadavre'Document13 pagesChina L'art Du Cadavre'antonio rincon nuñezNo ratings yet
- Benz Dostojewskij Und Die Russische Politik'Document13 pagesBenz Dostojewskij Und Die Russische Politik'antonio rincon nuñezNo ratings yet