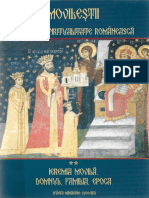Professional Documents
Culture Documents
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 viewsStadtarchaologie in Chemnitz
Stadtarchaologie in Chemnitz
Uploaded by
Mihai NastaseCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Movileștii Vol 2 2006Document436 pagesMovileștii Vol 2 2006Mihai NastaseNo ratings yet
- Cernovodeanu - Rezachevici (Ed.), Mihai Viteazul. Culegere de StudiiDocument142 pagesCernovodeanu - Rezachevici (Ed.), Mihai Viteazul. Culegere de StudiiMihai NastaseNo ratings yet
- Peter Pur TonDocument13 pagesPeter Pur TonMihai NastaseNo ratings yet
- Stanculescu Gheorghiu Stahl Petrescu Arhitectura-Populara-Romineasca 1957Document160 pagesStanculescu Gheorghiu Stahl Petrescu Arhitectura-Populara-Romineasca 1957Mihai Nastase100% (1)
- 31-MUZEUL NATIONAL XXXI 2019 p27 46 Weber GheorgheDocument20 pages31-MUZEUL NATIONAL XXXI 2019 p27 46 Weber GheorgheMihai NastaseNo ratings yet
- Cronica Cercetarilor Arheologice - 2021Document620 pagesCronica Cercetarilor Arheologice - 2021Mihai NastaseNo ratings yet
- Sevket PlovdivDocument78 pagesSevket PlovdivMihai NastaseNo ratings yet
Stadtarchaologie in Chemnitz
Stadtarchaologie in Chemnitz
Uploaded by
Mihai Nastase0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesStadtarchaologie in Chemnitz
Stadtarchaologie in Chemnitz
Uploaded by
Mihai NastaseCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
chsische Heimatblater 414 Stadarchologi in Cherite
Stadtarchaologie in Chemnitz
Christiane Hemker, Yves Hoffmann und Stefan Krabath
bb
Chemnitz, Stadtplan von
1788189, aufgenommen
und gezeichnet von
Friedrich Gotiob Aster.
1 UBchemata 8253-270,
1302-308, Al shete
‘aihinchen Uta
‘oe Papstrkunde ce ds
Patronat der Phrkirche aus
em ahr 254 een
spbbcen (eb 8 16ND,
2 Sebring 952
Die Anfiinge der Stadt Chemnitz —
Problemaufriss
Die Brahgeschichte der Stadt Chemnitz (Abb. 1)
‘war im 20, Jabrhundert immer wieder Gegen-
stand historischer Forschungen. Aufgrund der
Quellenarmut — cinschlieSlich der utkund
lichen und nichturkundlichen Quellen zum
BenediktinerKloster liegen bis zur Mitte des
13, Jahrhunderts lediglich sieben Sticke vor!
kommt zur Klirung der Frahgeschichte der
Stadt Chemnitz der Archiologie eine besonde-
re Rolle 2, Deswegen wird dieser Problematik
in der vorliegenden Untersuchung. erhohte
‘Aufimerksamkeit zuteil, obgleich die Archio-
int
logie daruber hinaus wichtige Ergebnisse vor-
zuweisen hat.
‘Als Meilenstein der historischen Forschungen
zur Frilgeschichte von Chemnitz ist die weit
‘ber diese Kommune hinausgreifende Mono-
srafie Walter Schlesingers uber Die Anfge der
Stadt Chemnitz und anderer mitteldentscher
Swidte aus dem Jahre 1952 2u bezsichnen.
Darin wies er nach, dass es sich bei Chemnitz
rmitnichten um eine wettinische sondern vie
mehr tum eine Kénigliche Stadtgrandung han
delt, dic auf die im Jahre 1136 durch Kaiser
Lothar II, (1125-1137) erfolgte Grindung des
Benediktinerklosters Chemnitz. folgte. Ein
Marktprivleg Konig Konrad IM, (1138-1152)
‘SSchsische Hematite 414
Stastarchiogi in Cernite
4 OG
E
etaing
mooi oung
prenereens
seen sane
acral esc Srache
tana iene 0
{(Rebtr nero nt)
a hate
ach ie 202
‘eirt en Yes Hann want Gh
“olanaanurtoncope 20
———_
400 180 200 250m
ar)
‘Ab, 2: Chemnit,Eintragung der Grabungsflichen seit 1953 mit Hervorhebung wichtiger Bauer,
‘Stchiche Heimatlatter 414
rliitieron 8; abn
4 Yop 1968, 5.28,
3) Bie Drteuchungen sid
iktang mur arzurchend
publi, water aber den
ier blannt, ihe dav:
ras 19645457; Deo
965 S185 (mit Grund)
Richter 19785 de 1985,
Sige
Teil 1965, 5. 830
‘sch Re 1973, 5.28
beso Keb 1983 1
9 Blache 1997 (1967), 5.1.
1 ‘Blschkaache 2013, 8
Mis 17- Vp kitich
Hofian 204
1 Kobuch 88
2 ll 18,16
3 Magis 199, 663; shai
3:
CChermitz Inere Kloster
strae mit Baugrubenprfl,
‘ufoahme 1961,
Statarchdclogie in Cherite
aus dem Jahre 1143 fiir das Kloster erlangte
wegen der ungiinstigen Bedingungen — so
Schlesinger ~ keine Wirksamkeit, so dass erst
tum 1165 Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152
1190) die Stadt in der Talaue an der heutigen
Stele griindete.
Dieser” Interpretation widersprach scheinbar
die architologische Befundlage (Abb. 2), da
nichst keine Funde aus dem 12. Jahrhundert
aus dem Stadtkernbekannt waren. Heinz
Joachim Vogt stellte fest, dass oftir das 13. und
breginnende 14. Jahrhundert mur aus zwei
Gebicten Fundmaterial vorliegt, wobei es sich
bei diesen keinesfalls um Funde aus der
1. Halfte des 13. Jahthundert sondern um solche
aus der Zeit nach der Mitte des 13. Jahrhun
derts handelt, wie der Ausgriber ausdriicklich
betont und was auch aus den Fundzeichnun-
gen hervorgeht.’ Vogt stete dabei sogar die
Frage inwieweit die » Talave der Chemnitz iber-
hhaupt fr die alteste Besiedlung in Frage komt
tund verwies bereits damals darauf, dass sich
odie urspringliche Loge der von Schlesinger fir
1165 erschlossenen Stadtgriindung [...] in erster
Linie durch weitere archiologische Untersuchu
_gen Kren lassen (wird)
Dieses Ergebnis 2weifelte Johannes Leipoldt
1965 mit den Worten »Das ist wenig wah
scheinlicke an und hielt-prinzipiell an der
Stadtentstchungstheorie Schlesingers fest?
Dagegen polemisierte in scharfer Form Ger-
hard Billig der es ebenso wie Vogt an der
notigen archiologischen Quellenkitik hat
mangeln lassen. Denn gegen cine solche Hypo
these sprach von Anfang an, dass aus dem
Stadtgebict lediglich Fundmaterial aus der
awciten Halfie des 13. Jahrhunderts vorlag, 0
ddass_man in der Konsequenz einer solchen
Interpretation die Griindung der Stadt Chem-
nite in der Talaue erst 2u einem solch spiten
Zeitpunkt anzunehmen hatte. Dagegen spra
chen jedoch die baubegleitenden Untersu
chungen Horst Richters in der Stadtkirche St
Jakobi, bei denen dieser 1953-1958/59 cine
romanische Saalkirche mit Querwestturm, ein-
‘gevogenem Chor und halbrunder Apsis ergra-
ben und zahlreiche romanische Bauplastik ber-
igen konnte, Der steinerne Erstbau wurde auf
1165, bow. um 1170/80 datiert,’ so dass sich
hieraus cine erhebliche Diskrepanz zu der
Interpretation Vogts und Bills ergab. Selbst
wenn man eine etwas spatere Frrichtung der
Jakobikirche 2u Beginn des 13. Jahrhunderts in
Betracht gezogen hatte, ware damit immer
noch nicht der Anschluss an die damals alte-
sten Funde aus dem Stadtkern aus der zweiten
Hialfte des 13. Jahrhunderts miglich gewesen.
Wie zu zeigen sein wird, hatte Leipoldt seine
‘Zweite iber die angebliche Siedlungsleere des
Chemnitzer Stadigebietes in der Zeit vor der
Mitte des 13. Jabrhunderts vollkommen 70
Recht geduBert.
Den klésterlichen Markt yon. 1143, dessen
Bestehen Schlesinger stark in Zweifel gezogen
hatte, lokalisierte Leipoldt bei der Nikolai-
Kirche und griff damit Argumente der alteren
Heimatforschung auf Diese Interpretation
wurde von Karlheinz Blaschke 1967 ausge-
‘aut,’ und im Laufe der Jahre mit zunchmen-
der Vehemeng vertreten.""
In einem die Diskussion sehr befruchtenden
Aufsatz ber Die Anfinge der Stadt Chemnitz
versuchte im Jahre 1983 Manfred Kobuch die
offenen Fragen 7u losen, wobei auch er dem
‘Trugschluss der angeblichen Siedlungsleere des
CChemnitzer Stadigebietes in der fraglichen Zeit
unterlag." Nach Kobuch sei die von Friedrich L
Barbarossa »nach 1170« gegriindete Stadt in
der Nahe der 1264 als Kénigskirche bezeugten,
extra murs gelegenen Johanniskirche zu loka:
lisieren, rst zu Beginn des 13. Jahrhunderts sei
cs zu einer Siedlungsverleyung,in die Chem-
nivaue gekommen und somit wire auch der
romanische Vorgingerbau von St. Jakobi erst
in das beginnende 13, Jahrhundert zu datieren.
Als Stadigrinder spricht er Konig Philipp von
Schwaben (1198-1208) an, Diesem Ansatz
folgte Billig 1988, wobei er neben Philipp aus-
Ariicklich sogar auch Kénig Friedrich IL
(1212-1250) in der Zeit von dessen erstem
Aufenthalt im regnum Teutonicur 1212-1220
als miglichen Stadtgriinder ins Spiel brachte.”
Die kunstgeschichtliche Forschung hielt hinge-
gen in durchaus schlissiger Argumentation an
der Unmiglichkeit einer solchen Spatdatie
rung der Chemnitzer Jakobikirche fest, wobei
Heinrich Magirius die Uberlegung anstlltes
dass vie bisher vorgeschlagenen Daten zwischen
1165-1180 |...] vielleicht bis gegen 1200« 2
exweitern waren, vaber nicht bis 1210-1220.”
~
Den entscheidenden Durchbruch erbrachten
Untersuchungen zur Frahgeschichte der gleich-
falls im Reichsland Pleigen gelegenen Stadt
‘wickau, Diese Kommune, wie spitestens seit
der eingangs genannten Untersuchung Schie-
singers bekannt ist, weist gro8e Parallelen 7
Chemnitz, auf, Insofern waren Zwickauer
Untersuchungsergebnisse der Jahre 1990-92
‘auch fiir die Chemnitzer Frithgeschichte von
Belang und sind sogleich auch fir Chemnitz
zum Vergleich herangezogen worden. Dies
tumso mehr, als sich auch der Vorgingerbau
der Zwickauer Marienkirche als Saalbau mit
‘Quervestturm, eingezogenem Chor und Apsis
vin nahecu villig iibereinstimmender Grumd-
rissdisposition« wie in Chemnitz herausgestellt
hatte." Folgerichtig schlossen sich der Histori-
ker Norbert Oelsner und die beiden Archiolo-
en Wilfried Stoye und ‘Thomas Walther zcit-
lich an die kunsthistorische Einordnung der
Chemnitzer Jakobikirche an und praferierten
erstmals auf der Tagung zu frithen Kirchen im
dlamaligen Landesmuseum flr Vorgeschichte
Dresden im Jahre 1992 ~ in Anlehnung an
Ferdinand Opll ~ eine Stadtgriindung in der
CChemnitzaue 2war noch unter Friedrich I. Bar-
barossa, jedoch nicht um 1165 sondern erst in
den 80erJahren des 12. Jahrhunderts.” Aus-
fiihrlicher auf Chemnitz ist Oelsner etwas spi-
ter noch einmal eingegangen und sprach si
dafir aus, auch fiir Chemnitz eine Griindung,
in »das ausgehende 12. J, insbesondere die spa-
ten 1180er Jahre, nicht aber die Herrschafisceit
Kénig Philipps 2u favorisieren.« Angesichts der
Befundlage Konnten tatsichlich mur neue
archdologische Untersuchungen. die offenen
Fragen kliten, wie bereits 1963 Heinz-Joachim
Vogt festgestellt hatte. Das betvtft auch die
Frage, ob vor der Stadtgriindung
cin kldstetlicher Markt ab 1143, baw. nach
Blaschke cine »Kaufmannssiedlungs des fri-
hen 12. Jahrhunderts existcrt hat.
Archiiologische Untersuchungen
is zum Beginn der 90er-Jahre
des 20. Jahrhunderts
‘An dieser Stelle ist es an der Zeit, auf die
bereits sporadisch gestreiften Ausgrabungen
im Stadtgebiet von Chemnitz etwas naher ein-
zugchen (Abb. 2). Wie Heinz-Joachim Vogt
1963 betonte, werden scit 1953 »in dent fast
villig zerstorten Zentrum [| im Zuge des
planmpigen Aufoaus —Stadtkernforschungen
durchgefihrte2” Auigrand des Personalmangels
rmussten sich diese jedoch auf baubeglitende
Untersuchungen. beschtanken, die zunachst
‘weitgehend allein vom drtlichen ehrenamt-
Staitarclogie in Chemnite
lichen Denkmalpfleger Horst Richter vorge-
nommen wurden." Etwas _umfangreicher
gestalteten sich die Untersuchungen in der
Inneren Klosterstrafe 1961 mit der baubeglei-
tenden Untersuchung einer groSen Baugrube
unmittelbar nérdlich der Marktkitche St. Jakobi
(Abb. 3). Als wichtiger Finzelfund konnte
damals auch ein kleines Topfchen vorgestelit
werden, das 1957/58 an der Fcke der heutigen
TheaterstraRe/Innere Klosterstrae geborgen
wurde. Das Pundstick datiert in die Mitte des
12, Jahrhunderts, wurde aber als Finzelfund
nicht fiir eine stadtgeschichtliche Interpreta-
tion in Anspruch genommen.
Besonders za erwihnen ist weiterhin die
Untersuchung der kriegszerstorten Ruine des
1481 gegrtindeten Franziskanerklosters mit
Kirche und Klausur durch Horst Richter 1954
1961. Die unmittelbar an der Stadtmauer im
Norden von Chemnitz. gelegene Anlage war
‘erst 1749 im Zuge des Neubaus der sogenann-
ten Neuen Johanniskirche abgebrochen wor-
den (Abb. 4)
In den 70er-Jahren erfolgten trotz weiterer
Baumafnahmen dann kaum noch archiologi-
sche Untersuchungen im Chemnitzer Stadtge-
bict, was vor allem den oben genannten Grin-
den geschuldet war. Erst mit dem Beginn der
Sanierung des Schlossbergmuseums — dem
Standort des 1539/40 aufgeldsten Benedikti-
netklosters ~ begannen dort infolge illegaler
Bodeneingriffe 1981 unter Leitung von Volk-
mar Geupel vom vormaligen Landesmuseum
fiir Vorgeschichte Dresden systematische Aus-
grabungen, bei denen es sich im strengen Sinne
jedoch nicht um stadtarchdologische Untersu-
chungen handelt, Die Grabungsergebnisse
sind neben den Ergebnissen zur Baugeschichte
des Klosters (Abb. 5) deswegen von besonderer
Wichtigheit auch fir die Stadt Chemnitz, weil
cine datierte Keramikstratigrafie ergraben wer-
den konnte, mit deren Hilfe andere archiologi-
Stchsische Heimablte ia
wee
ae
ao See.
soe Sy
kot
‘Ab A oben:
‘Chemnitz, Grundriss des 1481
‘geotndetenFranzskaner
klosters und der barocken
Neuen Johanniskirche,
Onder 198,882
Soper 1986, 5155.
15 Odenesoyervahe 1984,
555,158
16 Odaner 1985, 222-22¢
ris An. 32
1 Vogt 163,819.
gl Recherche 195,
19) Voge 1863; des 185,
Meche 19% des 1968.
20 Voge 1583, 12-136
es. 1985,8.206
21 Richer 19786
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Movileștii Vol 2 2006Document436 pagesMovileștii Vol 2 2006Mihai NastaseNo ratings yet
- Cernovodeanu - Rezachevici (Ed.), Mihai Viteazul. Culegere de StudiiDocument142 pagesCernovodeanu - Rezachevici (Ed.), Mihai Viteazul. Culegere de StudiiMihai NastaseNo ratings yet
- Peter Pur TonDocument13 pagesPeter Pur TonMihai NastaseNo ratings yet
- Stanculescu Gheorghiu Stahl Petrescu Arhitectura-Populara-Romineasca 1957Document160 pagesStanculescu Gheorghiu Stahl Petrescu Arhitectura-Populara-Romineasca 1957Mihai Nastase100% (1)
- 31-MUZEUL NATIONAL XXXI 2019 p27 46 Weber GheorgheDocument20 pages31-MUZEUL NATIONAL XXXI 2019 p27 46 Weber GheorgheMihai NastaseNo ratings yet
- Cronica Cercetarilor Arheologice - 2021Document620 pagesCronica Cercetarilor Arheologice - 2021Mihai NastaseNo ratings yet
- Sevket PlovdivDocument78 pagesSevket PlovdivMihai NastaseNo ratings yet